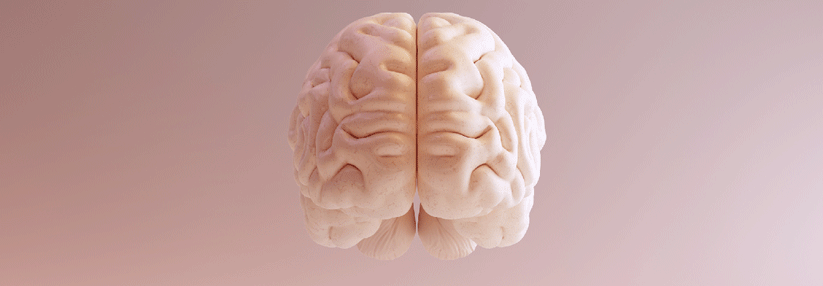Wie sinnvoll ist die Frühdiagnostik bei der Psychose?
 Das Screening nach psychischen Erkrankungen eignet sich eher für einen Ausschluss als zur Vorhersage.
© iStock/KatarzynaBialasiewicz
Das Screening nach psychischen Erkrankungen eignet sich eher für einen Ausschluss als zur Vorhersage.
© iStock/KatarzynaBialasiewicz
Schizophrenie und andere psychotische Störungen zählen zu den häufigsten Ursachen für eine Frühberentung bei jungen Erwachsenen. Die Mehrzahl der Patienten weist bereits mehrere Jahre vor Ausbruch der Psychose Symptome auf. Das ermöglicht eine wirksame Prävention, schreiben Privatdozentin Dr. Christina Andreou und Kollegen vom Zentrum für Psychotische Erkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel.
Jeder dritte Gefährdete erkrankt in zwei bis drei Jahren
Um bedrohte Personen zu erkennen, fahnden die Kollegen gezielt nach Prodromalsymptomen, die häufig im Vorfeld einer psychotischen Erstmanifestation auftreten (s. unterer Kasten). Die genauere Einschätzung des Risikos erfolgt mit strukturierten Interviews. So lassen sich frühe Beeinträchtigungen der Kognition und Wahrnehmung erfassen, die dem Patienten selbst auffallen (psychosefernes Prodrom). Ultrahochrisiko-Kriterien dienen dazu, die Gefahr für die folgenden zwölf Monate (psychosenahes Prodrom) zu ermitteln, sie enthalten drei Komponenten:
- attenuierte psychotische Beschwerden,
- kurz anhaltende, spontan remittierende psychotische Symptome und
- genetisches Risiko mit begleitendem Leistungsknick.
Risikofaktor Cannabis
Symptome stigmatisieren, nicht die Diagnose
Dazu stellen die Autoren klar: Therapie der Wahl bei hohem Risiko sind psychologische Interventionen. Leitliniengemäß darf der Einsatz von Neuroleptika erst nach einer erfolglosen psychologischen Intervention in Betracht gezogen werden – oder bei schweren bzw. fortschreitenden Symptomen. Ein weiterer Kritikpunkt, die mögliche Stigmatisierung, trifft nach Meinung der Experten ebenfalls nicht zu. Die Patienten fühlen sich vor allem durch ihre Symptome stigmatisiert, nicht durch die Diagnose. Die Früherkennung räumt mit Fehlinformationen auf und kann verspätete Therapien verhindern. Bei der Erstmanifestation einer Psychose ist dagegen die Behandlung mit Antipsychotika ganz klar erste Wahl. Und obwohl 20 % der Kranken nur eine Episode im Leben erleben, lohnt sich eine Neuroleptika-Prophylaxe. Sie bietet in den ersten zwei Jahren nach der primären Psychose maßgeblichen Schutz vor weiteren Episoden.Quelle: Andreou C et al. Swiss Med Forum 2019; 19: 117-123
Hier kann Frühdiagnostik sinnvoll sein
- Änderung des Sozialverhaltens ohne erkennbaren Grund (z.B. sozialer Rückzug, Wesensänderung)
- übermäßige Beschäftigung mit ungewöhnlichen Inhalten (esoterisch, philosophisch, religiös etc.)
- Änderungen von Wahrnehmung, Denkabläufen und -inhalten, die die Betroffenen als belastend erleben
- Störungen des Denkens (z.B. Verfolgungs- und Größenideen)
- neu auftretende formale Denkstörungen
- Leistungsknick bei Personen mit genetischer Veranlagung für Schizophrenie