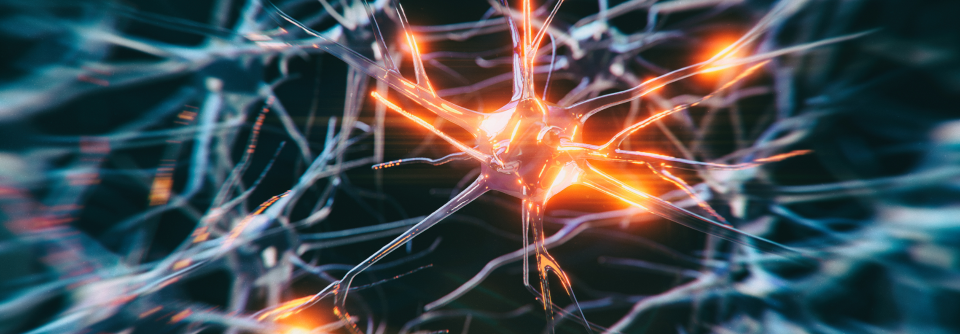Ungesunder Arztberuf Die Kollegen schaden sich vor allem selbst
 In der Karriere vieler Ärzt:innen kommt irgendwann der Punkt, an dem sie denken: "Jetzt reicht es!".
© W. Heiber Fotostudio – stock.adobe.com
In der Karriere vieler Ärzt:innen kommt irgendwann der Punkt, an dem sie denken: "Jetzt reicht es!".
© W. Heiber Fotostudio – stock.adobe.com
Ich mag Ärzte, aber ein bisschen irre sind wir schon“, sagte Prof. Dr. Jörg Braun von der Park-Klinik Manhagen in Großhansdorf. Dieses Irresein habe mit den übersteigerten Erwartungen an sich selbst sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht zu tun: Ein Arzt hat medizinisch alles zu wissen, er macht keine Fehler und er hat eine hohe kommunikative Kompetenz. Zu den Patienten ist er stets freundlich, gelassen und zugewandt, den Kollegen gegenüber immer ausgeglichen. Er ist unverwüstlich, was die eigene Gesundheit angeht. Er führt eine tolle Ehe, engagiert sich als Elternteil und im sozialen Bereich, treibt Sport und pflegt gehobene Hobbies wie Musik oder Golfen. Diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist eine Mission impossible, konstatierte Prof. Braun, zumal die verschiedenen selbstgesteckten Ziele häufig nicht kompatibel sind. Man denke da nur an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Fühlt sich ein Arzt krank, geht er in der Regel nicht zu einem Kollegen, der sich womöglich mit seinem Beschwerdebild besser auskennt als er selbst, sondern er doktert an sich herum. Die körperliche Untersuchung unterbleibt zumeist, was diagnostisch entweder zu Nihilismus oder zum Overkill führen kann. Gefördert wird dies alles durch eigene Ängste und Sorgen, mangelnde professionelle Distanz und teilweise fehlendes (Spezial-)Wissen.
Ohne korrekte Diagnostik erfolgt natürlich auch keine gezielte Therapie, d.h. der Arzt behandelt sich häufig nur symptomorientiert. Bei Beschwerden des Bewegungsapparats gibt’s ein Schmerzmittel, bevorzugt gleich Diclofenac. Entwickeln sich darunter Magenschmerzen, kommt flugs ein PPI dazu. „Von Atemwegsinfekten wissen wir zwar, dass sie meistens viral bedingt sind, aber sicherheitshalber nehmen wir dann doch das Antibiotikum“, bekannte Prof. Braun. Um nachts schlafen zu können, würden so manche Kollegen kurzerhand zur Schlaftablette greifen. Schließlich müssen sie am nächsten Tag fit für die Arbeit sein. „Wir nehmen hemmungslos abgelaufene Medikamente!“, berichtete Prof. Braun weiter. Erst kürzlich habe er gezögert, Penicillintabletten, die bereits 1999 abgelaufen waren, einfach wegzuwerfen.
Vier von fünf Ärzten arbeiten mit Krankheiten, bei denen sie ihre Patienten arbeitsunfähig geschrieben hätten. Trotz grippalem Infekt oder Durchfall erscheint jeder Zweite am Arbeitsplatz. Als Beispiel führte Prof. Braun den Fall eines Kollegen an, der trotz Erkrankung operierte und während des Eingriffs den Tisch viermal verlassen musste, um zur Toilette zu rennen.
„Ich habe nichts“
Ein chirurgischer Kollege kommt humpelnd zu Prof. Braun. Seine Beine sind stark geschwollen und schmerzen. Beidseits besteht ein Ulcus cruris. Er habe Rheuma, sein CRP sei erhöht, erklärt der Mann. Keinesfalls werde er aber Methotrexat einnehmen. Prof. Braun überweist den Patienten an eine Rheumatologin, die als Ursache der Symptome einen kompletten Vitamin-D-Mangel mit einem Spiegel unterhalb der Nachweisgrenze feststellt. Der Chirurg hat in letzter Zeit nahezu sein komplettes Leben in der Klinik verbracht und seit Jahren kein Sonnenlicht mehr abbekommen. Gegenüber Prof. Braun erklärt er später: „Die Rheumatologin sagt, ich habe nichts.“
Ärzte haben ein hohes Risiko für eine Substanzgebrauchsstörung, wobei die Alkoholabhängigkeit am häufigsten vorkommt. So werden z.B. etwa 15 % der Orthopäden aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch zumindest zeitweise arbeitsunfähig. Außerdem ist der Arztberuf die Profession mit der höchsten Suizidrate. Prof. Braun zitierte Daten aus der Washington Post, wonach in den USA jedes Jahr 150.000 Patienten ihren Arzt verlieren, weil dieser sich umgebracht hat. „Ich bin sicher, Sie alle kennen Kollegen, die irgendwann das Gefühl hatten: Jetzt reicht es.“
Prof. Braun geht davon aus, dass drei Faktoren zur erhöhten Suizidalität in der Ärzteschaft beitragen: Da ist zum einen die spezifische altruistische Persönlichkeit, die mit hoher beruflicher Identifikation, starkem Leistungsethos und erheblicher Kränkbarkeit einhergeht. Zum anderen wissen Ärzte sehr gut, wie man sich zielsicher suizidieren kann. Dazu kommen die schwierigen Arbeitsbedingungen sowohl in den Kliniken als auch in der Praxis mit hoher psychosozialer Belastung und Arbeitsdichte. Hilfsangebote speziell für gefährdete Ärzte fehlen aber weitgehend, sagte Prof. Braun.
Welcher Weg führt aus dem Dilemma? Benötigt werden klare Vorgaben von Kliniken bzw. Chefärzten, dass mit Infektionskrankheiten wie grippalem Infekt oder Durchfall nicht gearbeitet werden darf. Dies erfordert allerdings eine ausreichende Personaldecke. Ist diese zu dünn, muss ggf. die Patientenversorgung eingeschränkt werden, forderte Prof. Braun. Praxisinhaber sollten darauf vorbereitet sein, selbst krank zu werden, und ein Vertretungskonzept mit Vertretungsärzten oder einem Springerpool entwickelt haben. Krankheit sei ein planbarer Notfall, für den auch die MfA geschult sein sollten.
Wichtig ist, die eigene Resilienz zu stärken. Ärzte müssen lernen, Nein zu sagen, um überzogene Forderungen seitens der Patienten, Mitarbeiter, KVen oder Geschäftsführer abwehren zu können. Zudem sollten sie ihre eigenen Grenzen erkennen, insbesondere das schmeichelhafte, aber trügerische Bild des einzig wahren Retters ablehnen und dies entsprechend kommunizieren.
Nicht zuletzt motivierte Prof. Braun die Kollegen, über eigene Fehler zu sprechen, statt das Geschehene in sich hineinzufressen oder verdrängen zu wollen. Eine offene Aussprache sei z.B. in Mortalitäts-Morbiditäts-Konferenzen, Fauxpas-Clubs oder anonym über die Webseite jeder-fehler-zaehlt.de möglich.
Quelle: Kongressbericht