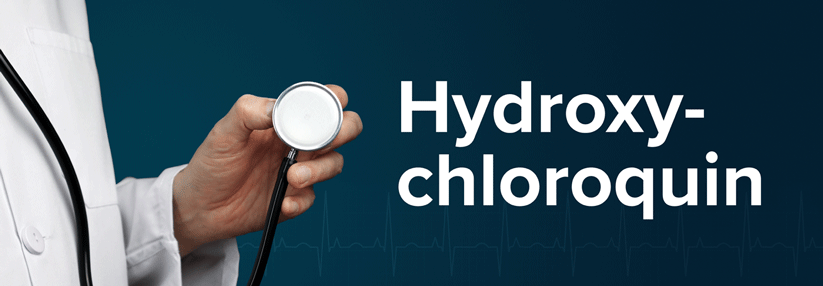Leukozyten-Antigen HLA B27 auf der Spur
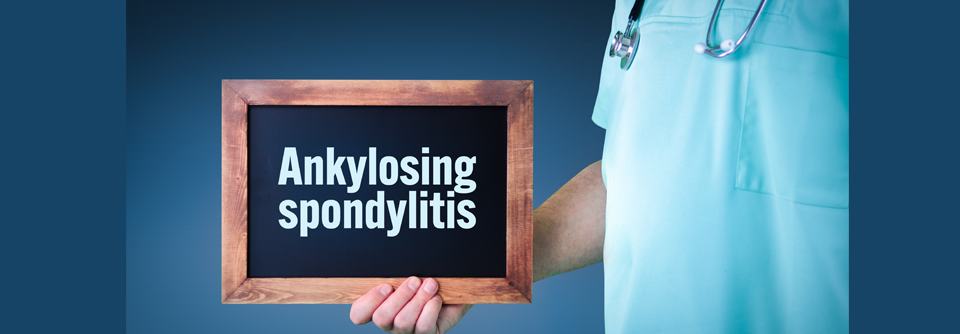 Bei Menschen mit AS hat HLA-B27 eine prognostische Bedeutung
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Bei Menschen mit AS hat HLA-B27 eine prognostische Bedeutung
© MQ-Illustrations - stock.adobe.com
Die Ätiologie der ankylosierenden Spondylitis (AS) ist noch lange nicht vollständig geklärt. Dennoch wissen wir schon eine ganze Menge über ihre Vererbbarkeit, unterstrich Prof. Dr. Jürgen Braun vom Rheumatologischen Versorgungszentrum Steglitz in Berlin. Monozygote Zwillinge von AS-Betroffenen haben ein mehr als 60%iges Risiko, die Erkrankung zu entwickeln, bei dizygoten liegt es mit etwa 8 % im Rahmen des Risikos für erstgradige Nachkommen. Eine finnische Untersuchung aus dem Jahr 2010 konnte zudem nachweisen, dass auch Verwandte zweiten und dritten Grades ein erhöhtes Risiko aufwiesen.
Die Heritabilität kann etwa 80–90 % der Krankheitsentstehung bei AS erklären. Insgesamt ist es ein polygenes Geschehen, bei dem über die Hälfte allerdings noch im Unklaren liegt. Den Haupteffekt auf das genetische Risiko hat mit etwa 20–30 % HLA-B27. Diese Assoziation von HLA-B27 und AS ist der stärkste bisher bekannte Zusammenhang zwischen einer HLA-Variante und einer menschlichen Erkrankung, betonte Prof. Braun.
Über 200 Varianten von HLA B27
Das HLA-System ist hochpolymorph, das bedeutet, dass es für die meisten HLA-Moleküle etliche Varianten gibt. Inzwischen kennt man über 200 verschiedene Allele von HLA-B27. In Europa sind HLA-B2702 und HLA-B2705 mit der AS assoziiert, HLA-B2706 und HLA-B2709 dagegen nicht. Offenbar ist es nicht von großer Bedeutung, ob HLA-B27 homozygot vorliegt. In einer finnischen Studie gab es bei Homozygozität zwar etwas schwerere Verläufe, der Unterschied war allerdings nicht besonders groß, sagte Prof. Braun.
Polymorphismen von ERAP1 spielen eine Rolle
Nichtsdestotrotz steht das humane Leukozyten-Antigen in der Ätiologie der AS nicht allein da. Es wurden inzwischen etliche ebenfalls beteiligte Gene identifiziert. Eine besonders wichtige Rolle spielen Polymorphismen von ERAP1. Diese Peptidase des endoplasmatischen Retikulums bestimmt, welches Peptid im B27-Molekül präsentiert wird. ERAP1 beeinflusst damit das AS-Risiko bei Menschen, die HLA-B27-positiv sind. Diese Erkenntnisse liefern starke Beweise dafür, dass HLA B27 bei der AS offenbar durch aberrante antigene Peptide arthritogen wirkt.
Zur Gruppe der mit HLA-B27 assoziierten Spondyloarthritiden gehören verschiedene Erkrankungen mit jeweils unterschiedlichem Anteil von HLA-B27-Trägern. In einer 2023 veröffentlichten Publikation waren-unter den AS-Erkrankten 94 % HLA-B27-positiv. Bei der colitisassoziierten Spondyloarthritis waren es 33–75 %, bei reaktiver Arthritis 30–75 % und bei Psoriasisarthritis (PsA) 40–50 %.
In vielen Situationen kann ein HLA-B27-Test diagnostisch genutzt werden. So macht ein positiver Test bei einem jungen Mann mit entzündlichem Rückenschmerz die Diagnose axiale Spondyloarthritis (axSpA) beispielsweise zehnmal wahrscheinlicher. HLA-B27-negative Menschen mit Rückenschmerzen haben dagegen oft eine PsA oder eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung.
Es ist wichtig, HLA-B27 immer im Zusammenhang mit anderen Faktoren zu beurteilen. Insgesamt hängt der Wert des HLA-B27-Tests für die Diagnose einer axSpa von verschiedenen Parametern ab. Dazu gehören:
- Häufigkeit von HLA-B27 in der Bevölkerung (8 % in Deutschland),
- Häufigkeit von HLA- B27 bei axSpA-Erkrankten (60 bis 90 %),
- Prä-Test-Wahrscheinlichkeit (Überweisung, Praxisspezialisierung).
Globales Nord-Süd-Gefälle
Die epidemiologische Bedeutung von HLA-B27 wird durch die weltweite Verteilung des Allels und der damit verbundenen Spondyloarthritiden unterstrichen. Die Inzidenzraten (IR) der SpA liegen zwischen 0,48 und 63/100.000, die Prävalenzraten zwischen 0,01 und 2,5 %. Auch die AS hat stark variierende Inzidenzraten (0,44 bis 7,3/100.000), ähnlich sieht es bei der Psoriasisarthritis aus (IR 3,6 bis 23,1/100.000). Die Häufigkeit der Erkrankungen hängt von der Prävalenz von HLA-B27 in der Bevölkerung ab. Dabei gibt es weltweit ein Nord-Süd-Gefälle. Zu erklären ist eine solche Verteilung damit, dass es irgendwann einmal einen Vorteil durch den Trägerstatus gegeben hat. Inzwischen ist bekannt, dass HLA-B27-positive Menschen günstigere Outcomes bei Infektionen mit Hepatitis C und HIV haben, außerdem präsentieren sie Influenzapeptide besser.
Polygene Risikoscores sind noch nicht praxistauglich
Eine etwas höhere diagnostische Ausbeute bietet der polygene Risikoscore. Bei diesem Verfahren werden gemeinsam mit HLA-B27 zahlreiche weitere, für Spondyloarthritiden relevante genetische Faktoren bestimmt. Diese tragen im Einzelnen zwar meist nur wenig zur Erkrankungswahrscheinlichkeit bei, sind aber in der Summe bedeutsam. Dabei bewerten die polygenetischen Scores das Risiko nicht kategorisch (positiv/negativ), sondern kontinuierlich. Das bedeutet, je mehr Gene man davon hat, desto wahrscheinlicher ist die Erkrankung. Praxistauglich sind diese Scores bis jetzt allerdings noch nicht, meinte Prof. Braun.
Auch aus prognostischer Sicht hat HLA-B27 eine gewisse Bedeutung. Es beeinflusst die Mortalität, allerdings einer britischen Untersuchung zufolge nur bei Menschen mit AS. HLA-B27-positive AS-Patientinnen und -Patienten hatten eine deutlich verkürzte Lebenserwartung, wobei dies für Frauen deutlicher war als für Männer. In der europäischen Bevölkerungskohorte der UK-Biobank war der HLA-B27-Status dagegen ohne Einfluss auf die Mortalität, zitierte Prof. Braun die britische Studie. Ob HLA-B27 auch mit der Krankheitsschwere assoziiert ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Studien zufolge vielleicht, allerdings gibt es für eine endgültige Bewertung zu wenige Patientinnen und Patienten, die HLA-B27-negativ sind, erklärte der Experte.
Zur Pathogenese der AS kursieren verschiedene Hypothesen. Aktuell im Vordergrund steht das arthritogene Peptid. Man geht davon aus, dass HLA-B27-Moleküle bestimmte krankheitsfördernde Peptide präsentieren, die sich mit spezifischen T-Zell-Rezeptoren verbinden und dadurch CD8-positive T-Zellen aktivieren. Diese Zellen weisen in ihren T-Zell-Rezeptoren das sogenannte TRBV9-Motiv auf. Es wird mit der Pathogenese von ankylosierender Spondylitis und Psoriasisarthritis in Verbindung gebracht. Genau gegen diesen T-Zell-Rezeptor hat eine russische Arbeitsgruppe einen Antikörper entwickelt. Er soll die selektive Eliminierung der TRBV9-T-Zellen im Rahmen einer zielgerichteten Therapie bei AS ermöglichen.
Bei einem Patienten hat dies offenbar funktioniert: Die Arbeitsgruppe publizierte Ergebnisse, nach denen mithilfe des Antikörpers TRBV9-positive T-Zellklone erfolgreich depletiert und eine Remission erzielt worden war. In einer RCT erreichte jeder Zweite der mit Anti-TRBV9-Antikörpern behandelten axSpA-Erkrankten nach 24 Wochen eine ASAS40, unter Placebo waren dies nur 24 %.
Noch ist es schwierig, diese Ergebnisse zu beurteilen, sagte Prof. Braun. Die dahintersteckende Idee sei allerdings hochinteressant. Denn wenn sich der T-Zell-Rezeptor bei der AS wirklich als die krankmachende Struktur herausstellt, wäre dieser Ansatz ein Schritt zur personalisierten Medizin, unterstrich der Experte.
Quelle: Deutscher Rheumatologiekongress 2024