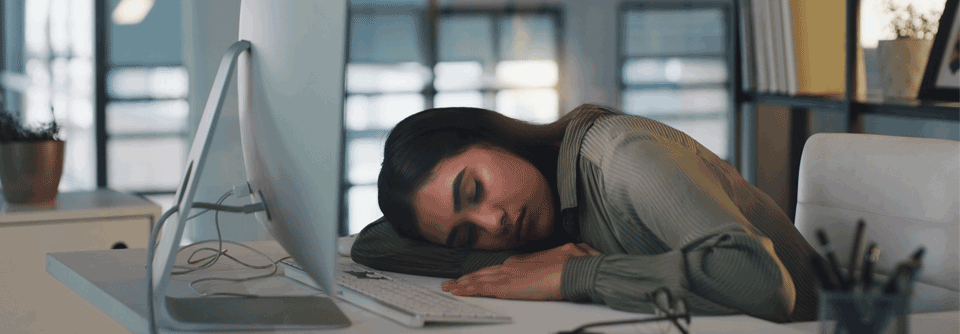
So grenzt man die Fatigue ein Müdigkeit, Depression oder extensive Erschöpfung?
 Müdigkeit und Erschöpfung können viele Ursachen haben. Bei chronisch Erkrankten handelt es sich häufig um eine Fatigue
© Pormezz - stock.adobe.com
Müdigkeit und Erschöpfung können viele Ursachen haben. Bei chronisch Erkrankten handelt es sich häufig um eine Fatigue
© Pormezz - stock.adobe.com
Bei einer Fatigue im Rahmen chronischer Erkrankungen erleben Betroffene eine anhaltende Müdigkeit, körperliche Abgeschlagenheit, Schwäche und ein Schweregefühl der Muskulatur. Erholungszeiten ändert nichts oder kaum etwas daran, schreibt Prof. Dr. Joachim Weis vom Tumorzentrum/Comprehensive Cancer Center der medizinischen Fakultät der Universität Freiburg.
Solche Fatigue-Zustände treten beispielsweise bei malignen Tumoren, rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose und einem Morbus Parkinson auf. Ätiologie und Pathogenese dieses Erschöpfungszustands sind bisher noch nicht gänzlich geklärt, aber es wirken zusammen:
- physische Faktoren wie Schwächegefühl und fehlende Ausdauer,
- kognitive Faktoren wie Konzentrationsprobleme und Schwierigkeiten mit dem Kurzzeitgedächtnis, und
- emotionale Faktoren wie Antriebs- und Interesselosigkeit.
Dabei kann die Fatigue in manchen Fällen der Erkrankung bzw. Diagnose um Jahre vorausgehen. Dies ist z. B. bei multipler Sklerose der Fall und wurde auch schon bei Malignomen beobachtet. Allerdings tritt bei Letzteren die Fatigue auch während oder nach der Therapie auf.
Vermutet man bei einem chronisch Erkrankten eine Fatigue, steht als Erstes ein Screening mit einer numerischen Rating-Skala an. Der Betroffene soll seine Beschwerden zwischen 0 (keine Erschöpfung) und 10 (schlimmste vorstellbare Erschöpfung) einordnen. Ist die Fatigue moderat oder stark ausgeprägt (Werte ≥4), wird eine vertiefende Diagnostik empfohlen. Dafür erhebt man zunächst eine gründliche Anamnese und erfragt dabei
- die aktuellen Beschwerden und in welchem Ausmaß sie den Alltag behindern
- die Entwicklung und den Verlauf des Syndroms: vor oder nach der Diagnose der Grundkrankheit; vor, während oder nach der Therapie; Verlauf über den Tag
- den Stand der Grundkrankheit (Remission, stabil, Progression) und die dabei eingesetzte Therapie
- Schlafstörungen, körperliche Aktivität und Ernährung
- regelmäßig eingenommene Medikamente sowie Alkohol- und/oder Drogenkonsumdie psychosoziale Situation, etwa Stress im Beruf, mit dem Partner bzw. der
- Partnerin, Umweltbelastungen
Eine Reihe dieser Beschwerden passt auch zu einer klinischen Depression, beispielsweise Schlafstörungen oder psychosozialer Stress. Fatigue und Depression lassen sich aber mithilfe des „Zwei-Fragen-Tests“ abgrenzen (Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig bedrückt oder hoffnungslos? Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?).
Dazu kommt eine orientierende körperliche Untersuchung mit Abklärung der verschiedenen Organsysteme (kardial, pneumologisch, gastrointestinal etc.). Bei allen Befunden und Beschwerden muss abgewogen werden, ob sie durch die Primärerkrankung oder durch die Fatigue bedingt sind. Fatiguespezifische Fragebogen können hier hilfreich sein, etwa die Fatigue Severity Scale oder die Fatigue-Skala. Man kann jedoch auch unspezifische Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität einsetzen, wie den SF12 oder den SF36, und dort die passenden Dimensionen prüfen.
Im Labor fordert man zunächst nur den üblichen Standard an: kleines BB, Elektrolyte, Leber- und Nierenwerte, TSH und Glukose; weitere Checks sind abhängig von den Symptomen. Röntgen und ähnlich invasive Test sind nur nach Bedarf notwendig, der sich aus der Anamnese ergibt.
Erhärtet sich der Verdacht auf die Fatigue und wurden Differenzialdiagnosen wie multiple Sklerose, Morbus Parkinson oder psychiatrische Erkrankungen ausgeschlossen, hängt das weitere gezielte Vorgehen von den Befunden ab. So kann eine Überweisung in entsprechende Fachbereiche notwendig sein. Überhaupt gelingt eine erfolgreiche Verminderung der Fatiguebeschwerden meist nur im multidisziplinären Team, betont der Experte.
Quelle: Weis J. Bundesgesundheitsbl 2024; 67: 1231-1238; doi: 10.1007/s00103-024-03951-0


