
Cartoon Medizin und Markt
DGfN-Update: CKD früh erkennen und Progression verzögern
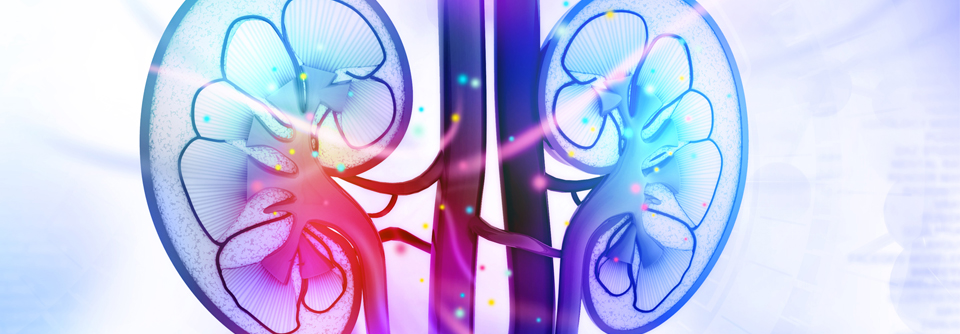 © iStock/HYWARDS
© iStock/HYWARDS
Die Früherkennung mittels diagnostischer Parameter wie der Albuminurie spielt eine entscheidende Rolle für die rechtzeitige Einleitung einer nephroprotektiven Therapie und dementsprechend auch für die Prognose der Patienten. Denn eine nicht adäquat behandelte Nierenfunktionsstörung kann zu einer terminalen Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht führen. Das Risiko für kardiovaskulär bedingte Morbidität und Mortalität steigt bei Patienten mit T2D und CKD ebenfalls.1
Diagnostik: UACR und eGFR mit prognostischer Relevanz
Für die Diagnose von CKD bei T2D sind besonders zwei Laborparameter entscheidend: der Albumin-Kreatinin-Quotient im Urin (urine albumin creatinine ratio, UACR) als Indikator für eine Nierengewebeschädigung sowie die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (estimated glomerular filtration rate, eGFR) als Indikator der Nierenfunktion. Anhand der Betrachtung beider Werte lassen sich Aussagen über strukturelle und funktionelle Veränderungen der Niere und über das kardiovaskuläre Risiko der Patienten sowie das Sterberisiko treffen.4 Die internationale nephrologische Fachgesellschaft Kidney Diseases Improving Global Outcomes (KDIGO) empfiehlt in Abhängigkeit vom Schweregrad der CKD, die beiden Untersuchungen mindestens einmal jährlich – in fortgeschrittenen Stadien häufiger – zu wiederholen.5
Interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt
Aus der Kombination von UACR-Stadien und eGFR-Kategorien hat die KDIGO eine 18-Felder-Tafel für die Stadieneinteilung der CKD abgeleitet.5
Abhängig vom Stadium der CKD sollten 1-4 mal pro Jahr folgende Werte kontrolliert werden6:
- eGFR (Schwellenwert 60 ml/min/1,73 m2)
- UACR (Schwellenwert 30 mg/g)
- Blutdruck (Zielwert: ≤130/80 mmHg)
- HbA1c (Zielwert: 6,5-7,5 %)
- Lipide (besonders LDL-Cholesterin, ggf. Triglyzeride)
Ab Stadium G3a empfiehlt die Deutsche Diabetes Gesellschaft eine Überweisung zum Nephrologen. Bei älteren Patienten ab Stadium G3b. Bei jeder höhergradigen Funktionseinschränkung oder Nierenerkrankungen, die nicht durch T2D verursacht wurden, sollte der Nephrologe umgehend konsultiert werden.6
Um das Risiko der Patienten für eine Progression der Nierenerkrankung und kardiovaskuläre Ereignisse einschätzen zu können, ist eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Hausarzt, Nephrologen und Diabetologen erforderlich. Diese beginnt mit dem Screening durch einen einfachen Urintest in der Hausarztpraxis und wird durch weitere Diagnostik mit Bestimmung von UACR und eGFR in der fachärztlichen Praxis ergänzt.
Bei der 13. Jahrestagung des Deutschen Gesellschaft für Nephrologie sprachen wir mit dem Nephrologen Prof. Dr. med. Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie am Universitätsklinikum Würzburg, über die Diagnostik und die neue Studienlage im Hinblick auf neue Therapieoptionen mit nephro- und kardioprotektiven Eigenschaften.
Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonist als mögliche neue Therapieoption
1 Afkarian M, et al. JASN 2013;24:302-308
2 Anders HJ, et al. Nat Rev Nephro 2018;361-377
3 Thomas MC, et al. Nat Rev 2015;1:1-19
4 KDIGO 2020 Clinical practice guideline on diabetes management in chronic kidney disease. Kidney International 2020; 98: S1–S115
5 KDIGO 2012. Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International 2013;3:S1–S150
6 Merker L, et al. Diabetologie 2020; 5 (Suppl 1):S170–S174
7 Finerenone benefits patients with diabetes across spectrum of kidney disease (escardio.org) Filippatos G. Abstract 7161 presented at the European Society of Cardiology 2021 (ESC 2021)
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).

