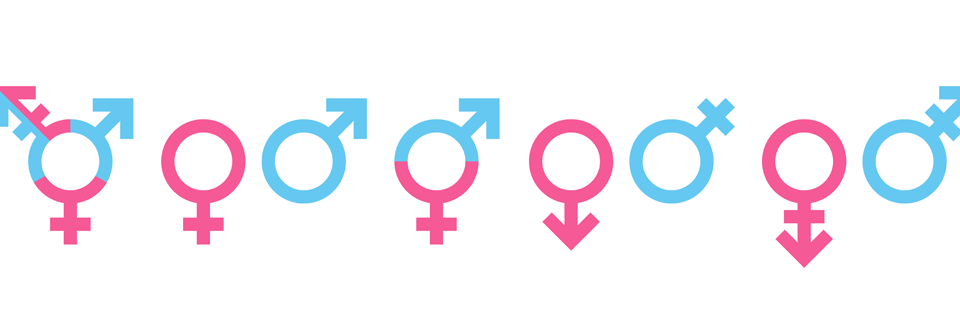
Der Vielfalt affirmativ begegnen
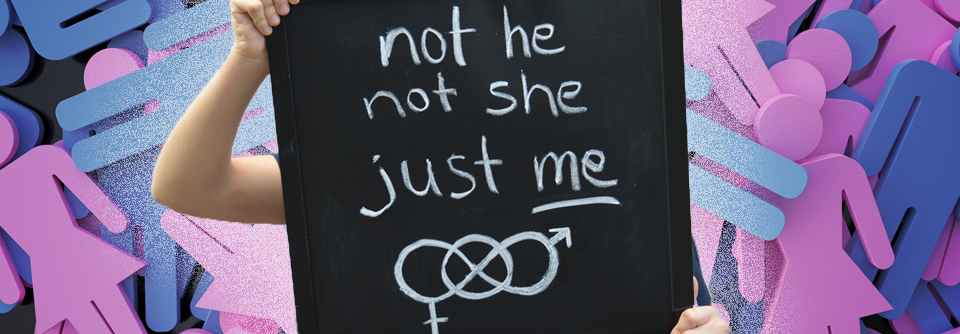 Mögliche Transitionsmaßnahmen lassen sich in die drei Bereiche sozial, juristisch und medizinisch unterteilen.
© vchalup, RS-photography – stock.adobe.com
Mögliche Transitionsmaßnahmen lassen sich in die drei Bereiche sozial, juristisch und medizinisch unterteilen.
© vchalup, RS-photography – stock.adobe.com
Gemäß aktueller ICD-11 handelt es sich bei der Inkongruenz zwischen dem am Lebensanfang festgelegten Geschlecht und der empfundenen Identität um einen Gesundheitszustand und nicht um eine psychische Störung.
In vielen Fällen führen die Abweichungen von körperlichen, psychischen und/oder sozialen geschlechtlich normierten Merkmalen bei Betroffenen zu einer Geschlechtsdysphorie mit teils gravierenden Folgen. Doch ist das Geschlecht nicht als binär, sondern vielmehr als Kontinuum und somit jede Geschlechtsidentität als Normvariante zu betrachten, schreiben Hannes Rudolph von HAZ – Queer Zürich und Kolleg:innen.
Prävalenz von gender Normvarianten
Internationalen Schätzungen zufolge identifizieren sich zwischen 0,3 % und 0,5 % der Erwachsenen als trans. Bei Kindern und Jugendlichen sind es 1,2 % bis 2,7 %. Etwas weiter gefasst sehen zwischen 0,5 % und 4,5 % der Erwachsenen und 2,5 % bis 8,4 % der Kinder und Jugendlichen bei sich eine gender diversity.
Diese neue Sichtweise führt zu einem Paradigmenwechsel in Diagnostik und Therapie. Nach heutigem Verständnis sind Menschen mit Geschlechtsinkongruenz selbst die Expert:innen für die Wahrnehmung, Definition und Gestaltung ihres eigenen Geschlechts, so das Autorenteam. Dementsprechend stehen ihre Aussagen hinsichtlich der Spannungen zwischen Geschlechtskörper, -identität und -rolle im Zentrum der Diagnostik. Dieser Selbsteinschätzung dürfen Behandelnde vertrauen.
Die Diagnose Geschlechtsinkongruenz – nach wie vor Grundlage für eine Behandlung – kann daher von jeder medizinischen Fachperson gestellt werden, so die Autoren. Psycholog:innen und Psychiater:innen sind für die Diagnose in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich. Gefragt sind sie jedoch, wenn der Wunsch nach Klärung offener Identitäts- oder Transitionsfragen, der Wunsch nach Unterstützung während der Transition oder begleitende psychische Störungen bestehen. Die Koordination der Transition kann auch durch andere medizinische Fachdisziplinen oder Peers erfolgen.
Schritte zur Angleichung berühren viele Disziplinen
Mögliche Transitionsmaßnahmen betreffen eine Reihe von unterschiedlichen Aspekten. Sie lassen sich in die drei Bereiche sozial, juristisch und medizinisch unterteilen:
- In den sozialen Bereich fallen das Coming-out, die Verwendung eines neuen Namens, der Wechsel von gegenderten Gruppen (z.B. im Sport), die Veränderung des äußeren Erscheinungsbilds (z.B. Kleidung, Frisur, Make-up), der Wechsel von Anrede und Pronomen sowie der Wechsel von geschlechtsgebundenen Räumen (z.B. Toiletten, Garderoben).
- Als juristische Maßnahmen sind die Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags und des Vornamens zu nennen.
- Medizinische Behandlungen betreffen die Fachrichtungen Reproduktionsmedizin, Endokrinologie, Dermatologie, Phoniatrie und Chirurgie.
Wie die Autor:innen betonen, ist gemeinsam mit den Behandlungssuchenden im Sinne eines shared decision making zu entscheiden, ob und in welcher Reihenfolge sie Maßnahmen umsetzen wollen. Anders als früher geht es nicht mehr um eine vollständige Anpassung an das andere Geschlecht (entsprechend einer normativen Geschlechtsvorstellung), sondern vielmehr um individuelle und bedürfnisorientierte Lösungen. Eine zentrale Rolle spielt die affirmative Haltung der Behandelnden, durch die Betroffene darin unterstützt werden, ihr Geschlecht in allen Komponenten zu erforschen, zu festigen und zu integrieren.
Trans und cis
Das Adjektiv trans (oder transgender) beschreibt Personen, deren empfundenes Geschlecht nicht mit demjenigen übereinstimmt, das man ihnen bei Geburt aufgrund der Genitalien zugewiesen hat. Eine trans Frau identifiziert sich demnach selbst als Frau, obwohl sie offiziell als Mann gilt. Bei einem trans Mann ist es entsprechend umgekehrt. Menschen, deren Identität und Zuweisung kongruent sind, werden als cis bezeichnet.
Insgesamt zielt die Behandlung darauf ab, die Geschlechtsinkongruenz zu verringern. Wichtig dabei ist, dass alle Maßnahmen zusammenspielen. Insbesondere für soziale Maßnahmen gilt, dass sie schon früh in ausgewählten Situationen gelebt werden können, z.B. gegenüber bestimmten Personen, an bestimmten Orten oder in einzelnen Lebensbereichen. Dies bietet nicht zuletzt die Gelegenheit, Entscheidungen zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen.
Gebrauch der gewünschten Anrede zeugt von Respekt
Die Autor:innen betonen, dass das Coming-out einen Vertrauensbeweis gegenüber der medizinischen Fachperson darstellt. Denn trotz des gesellschaftlichen Wandels hafte dem Thema Geschlechtsinkongruenz noch immer ein Stigma an. Respekt könne man durch eine affirmative Haltung ausdrücken, die sich bereits in der Verwendung der korrekten Anrede (im Zweifel nachfragen) zeige. Mit Unsicherheit und Zweifeln seitens der Behandlungssuchenden müsse man rechnen, dies sei immer Teil des Prozesses. Eine wichtige Rolle können in diesen Situationen Peer-Berater:innen einnehmen.
Quelle: Rudolph H et al. Swiss Med Forum 2023; 23: 856-860; doi: 10.4414/smf.2023.09300
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).
