
So ist der Stand der Forschung bei anhaltenden Symptomen nach COVID-19
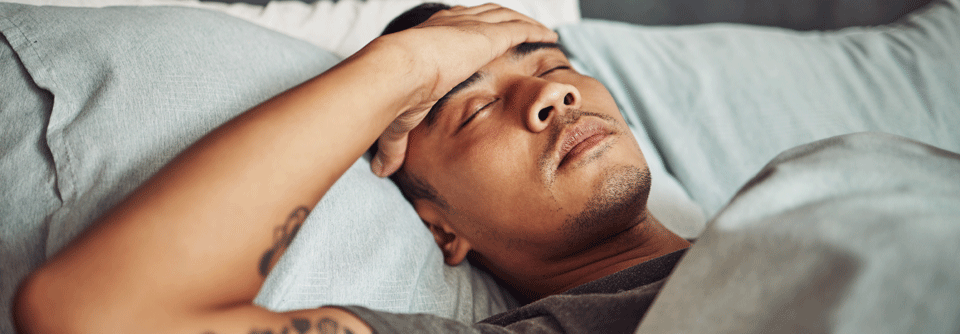 Anhaltende Erschöpfung, kognitive und körperliche Beeinträchtigungen, gestörte autonome Funktionen und psychische Symptome: Die Beschwerden beim Long- bzw. Post-COVID-Syndrom (PCS) sind äußerst vielfältig.
© Clement C/peopleimages.com - stock.adobe.com
Anhaltende Erschöpfung, kognitive und körperliche Beeinträchtigungen, gestörte autonome Funktionen und psychische Symptome: Die Beschwerden beim Long- bzw. Post-COVID-Syndrom (PCS) sind äußerst vielfältig.
© Clement C/peopleimages.com - stock.adobe.com
Anhaltende Erschöpfung, kognitive und körperliche Beeinträchtigungen, gestörte autonome Funktionen und psychische Symptome: Die Beschwerden beim Long- bzw. Post-COVID-Syndrom (PCS) sind äußerst vielfältig. Zur Feststellung dieser Ausschlussdiagnose sind diverse Untersuchungen erforderlich, die ggf. in einem spezialisierten Zentrum erfolgen müssen. Vom Blutgefäß über den Darm bis zu den Mitochondrien können Studien zufolge ganz unterschiedliche Organsysteme bei diesem Syndrom eine Dysfunktion aufweisen, schreiben Dr. Sinem Koc-Günel und Prof. Dr. Maria Vehreschild vom Universitätsklinikum Frankfurt.
Auch wenn es immer noch keine eindeutige kausale Erklärung für PCS gibt, sind viele Teile des Puzzles bereits recht gut erforscht. Offenbar persistiert SARS-CoV-2 bei einigen Betroffenen nach der akuten Infektion, zudem können andere Viren reaktiviert werden – beides wird als möglicher Auslöser für Long COVID diskutiert. Unter den Viren, die vermutlich „erwachen“ können, befinden sich u. a. das Epstein-Barr- und das Zytomegalie-Virus, die humanen Herpesviren 6 und 7 sowie humane endogene Retroviren.
In Bezug auf das Immunsystem gibt es außerdem Hinweise auf autoimmune Prozesse, was sich in entsprechend veränderten Zahlen mancher Immunzellen und -mediatoren widerspiegelt. Studien zeigten zudem einen Zusammenhang zwischen anhaltender Immunaktivierung und einer gestörten Mitochondrienfunktion.Viren können die mitochondriale Energieversorgung des Wirts zu ihren Gunsten drosseln. Nimmt das mitochondriale Erbgut dauerhaft Schaden, so hält die gestörte Funktion auch nach der akuten SARS-CoV2-Infektion an („Hit-and-Run-Hypothese“). Der beeinträchtigte Energiemetabolismus kann mit Fatigue, Muskelschwäche und kognitiven Einschränkungen einhergehen.
Gedächtnisprobleme durch Dysfunktion der Blutgefäße
Andere Symptome wie Konzentrations- und Gedächtnisprobleme oder auch psychische Beschwerden können – neben kardiologischen Beschwerden – Folge einer Dysfunktion der Blutgefäße sein. Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine gestörte Endothelfunktion eine wichtige Rolle bei den vielfältigen PCS-Symptomen spielt. In Bezug auf die Herz-Kreislauf-Funktion ist zudem die für PCS oft typische autonome Dysfunktion zu nennen. Einige Genesene, aber auch gegen SARS-CoV-2 Geimpfte, leiden im Verlauf z. B. am Posturalen Tachykardiesyndrom (POTS): Nach dem Aufstehen kommt es zu einer überschießenden Tachykardie, oft begleitet von Fatigue, orthostatischer Intoleranz, „Brain Fog“ und Brustschmerz.
Auffällig waren in Untersuchungen mit einigen PCS-Betroffenen auch bestimmte Veränderungen der Darmmikrobiota. Neben einer verringerten Diversität zeigten sich Besonderheiten in der Zusammensetzung der Bakterien, Pilze und Viren in der Darmflora der Betroffenen.
Verändertes Darmmikrobiom schränkt Immunsystem ein
Ein gestörtes Darmmikrobiom kann Studien zufolge nicht nur mit Einschränkungen des Immunsystems, sondern auch mit neurologischen und psychiatrischen Symptomen einhergehen. Wie neuere Studien nahelegen, könnte das Darmmikrobiom eine Schlüsselfunktion für den Verlauf und den Schweregrad eines PCS haben.
Vor dem Hintergrund der pathophysiologischen Erkenntnisse zeigen die Autorinnen verschiedene potenzielle Therapieoptionen bei PCS auf, die aber bisher off label eingesetzt werden: Betablocker oder Ivabradin können gegen POTS helfen, Pyridostigmin oder Vericiguat die Durchblutung fördern. Naltrexon (niedrig dosiert) oder Bupropion verbessern die Fatigue und die Neurokognition, während Antihistaminika und Statine u. a. entzündungshemmend wirken. Pregabalin und Duloxetin können Schmerzen reduzieren, Aripiprazol (niedrig dosiert) mildert offenbar den „Brain Fog“ und Venlafaxin hilft gegen serotoninassoziierte Symptome. Auch verschiedene antivirale Wirkstoffe werden erforscht.
Wichtig ist den Autorinnen zufolge die Einbettung medikamentöser Ansätze in eine multimodale Therapie inklusive Physiotherapie. Das Behandlungsangebot sollte Atemtherapie, kognitive Rehabilitation, psychosoziale Unterstützung, psychosomatische Therapie und Ergotherapie sowie Logopädie umfassen. Speziell bei PCS gilt zudem, dass sich die Symptome der Fatigue eher kontrollieren lassen, wenn die Betroffenen lernen, im Alltag ihre Energie gut einzuschätzen und Überlastungen zu vermeiden („Pacing“-Techniken).
Quelle: Koc-Günel S, Vehreschild M. Hessisches Ärzteblatt 2025; 86: 124-129
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).



