Arzthaftpflicht Diagnose- und Befundfehler
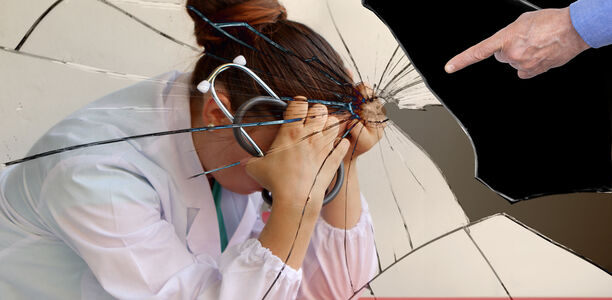 © kittyfly - stock.adobe
© kittyfly - stock.adobe
Anfang November dieses Jahres wurde ein einschlägiges Gerichtsurteil gesprochen, bei dem das Uniklinikum Gießen aufgrund eines Behandlungsfehlers zu einer Rekordsumme von 800.000 Euro Schmerzensgeld verklagt wurde. Was war passiert? Eigentlich war es ein Routineeingriff, als sich 2013 ein 17-Jähriger nach einer Sportverletzung einer Operation an der Nase unterzog. Doch während des Eingriffs passierte ein schwerwiegender Fehler: Die Schläuche des Beatmungsgeräts wurden falsch angeschlossen und es kam zu einer Sauerstoffunterversorgung mit der Folge, dass der Jugendliche irreversible Hirnschäden erlitt und zum Pflegefall wurde.
Der Diagnosefehler
Auch wenn die Gefahr von Fehlern mit solch weitreichender Konsequenz i. d. R. eher bei Facharztgruppen wie Anästhesisten oder Chirurgen besteht, werden natürlich auch Hausärzte immer wieder einmal mit der Angst vor einem Behandlungsfehler konfrontiert. Kommt es hart auf hart und der Fehler führt zu einem Gerichtsverfahren, wird genauestens geprüft, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Vorwissen der Fehler passierte. Eine wichtige Unterscheidung wird zwischen Diagnose- und Befunderhebungsfehler getroffen. Bei Ersterem kommt es oftmals nicht zu einer Arzthaftung, denn die Gerichte gehen von einer gewissen Unabwägbarkeit und Unterschiedlichkeit des menschlichen Körpers aus und sind bei reinen Diagnosefehlern eher zurückhaltend bei der Verurteilung [1]. Doch manchmal sind die Übergänge fließend und aus einem Diagnosefehler kann schnell ein Befunderhebungsfehler werden, bei dem der Arzt stärker in die Verantwortung gezogen und damit u. U. haftbar gemacht wird.
Ein Beispiel aus der Hausarztpraxis: Eine Patientin kommt im Winter mit den für diese Jahreszeit klassischen Erkältungssymptomen (Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost) in die Praxis. Der Arzt diagnostiziert einen grippalen Infekt. Aufgrund der typischen Symptome erfragt er keine weiteren Besonderheiten und erfährt somit nicht, dass die Patientin erst kürzlich aus einem längeren Urlaub in Zentralafrika zurückgekehrt ist. Später stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen grippalen Infekt, sondern um eine Malariaerkrankung handelt. Bei der ersten Vorstellung der Patientin handelt es sich zunächst um einen reinen Diagnoseirrtum bzw. -fehler, da aufgrund der Symptome und des Verlaufs sowie der Häufung der Diagnose zu dieser Jahreszeit ein grippaler Infekt so naheliegend ist, dass der Arzt hiervon ausgehen durfte – zumal er von der Afrikareise nichts wusste. Mit einer Arzthaftung wäre in diesem Fall nicht zu rechnen.
Der Befunderhebungsfehler
Anders verhält es sich, wenn sich zwei Wochen später der Zustand der Patientin verschlechtert hat (zusätzlich starke Kopfschmerzen und Erbrechen) und sie erneut in der Praxis vorstellig wird, ohne dass der Arzt die Diagnostik erweitert und eine tiefergehende Anamnese durchführt. An dieser Stelle müsste der Arzt aufgrund des untypischen Verlaufs seine ursprüngliche Diagnose "grippaler Infekt" hinterfragen. Bleibt der Arzt jedoch bei seiner Verdachtsdiagnose, geht lediglich von einem schweren Verlauf aus und setzt die Behandlung entsprechend nicht zielführend fort (verschreibt z. B. ein Antibiotikum), so liegt ein Befunderhebungsfehler vor, da weitere notwendige Tests und Untersuchungen, die die Diagnose hinterfragen, bestätigen bzw. korrigieren können, unterlassen wurden.
Man kann sich vorstellen, dass eine Differenzierung zwischen Diagnose- und Befunderhebungsfehler nicht immer einfach ist und stark vom Einzelfall abhängt. Bei dem Versuch, beide voneinander abzugrenzen, spricht man auch von dem "Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit", d. h. der Klärung, ob der Hauptfehler in der falschen Diagnose oder in der mangelnden Untersuchung liegt. Die Differenzierung wird noch hierdurch erschwert, dass unterschieden wird zwischen leichtem und grobem Diagnosefehler und dementsprechend leichtem und grobem Befunderhebungsfehler.
EXKURS: Aufbewahrung von Befunden
Nicht nur für mögliche juristische Nachfragen, auch um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Diagnostik zu veranlassen, müssen Sie als Arzt Ihrer Dokumentationspflicht nachkommen. Zu der Dauer der Aufbewahrung heißt es in § 630 Abs. 3 BGB: "Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbewahrungsfristen bestehen." Empfohlen wird, die Patientenakte auch über die zehn verpflichtenden Jahre hinaus möglichst lang aufzubewahren, um sich vor potenziellen Anschuldigungen oder Forderungen zu schützen [1].
Diese Regelaufbewahrungsfrist gilt im Übrigen auch nach Praxisauf- oder -übergabe. Übernimmt ein Kollege die Praxis, kann die Patientenakte unter Bewahrung der Schweigepflicht übergeben werden. Möchte sich ein Praxisinhaber zur Ruhe setzen, findet aber keinen Nachfolger und ist gezwungen, die Praxis zu schließen, muss er für die Patientenakten trotzdem einen geeigneten Aufbewahrungsort finden, um die Frist zu gewährleisten. Auch im Falle des Todes des Praxisinhabers – und im Übrigen auch des Patienten – gibt es keine Fristverkürzung. Stirbt der Praxisinhaber, sind die Erben in der Verantwortung, die Aufbewahrung zu organisieren [1].
Einfacher oder grober Fehler?
Ein einfacher Diagnosefehler zeichnet sich dadurch aus, dass sein Hergang nachvollziehbar und aus medizinischer Sicht vertretbar erscheint. Ähnlich verhält es sich bei einem einfachen Befunderhebungsfehler: Dieser ist zwar formal nicht ganz klar definiert, doch handelt es sich um einen Fehler, der einem Arzt nach allgemeinem Verständnis durchaus unterlaufen kann.
In welche Kategorie der Fehler eingestuft wird, schlägt sich vor Gericht bei der Zuteilung der Beweislast nieder. Bei einem leichten Diagnosefehler liegt die Beweislast bei dem Patienten, d. h. er selbst muss den begangenen Fehler des Arztes und den daraus resultierenden Schaden, also einen kausalen Zusammenhang beweisen. Dies ist in der Regel ziemlich schwierig. Schafft der Patient dies nicht, verliert er den Prozess. Zwar läge auch bei dem einfachen Befunderhebungsfehler die Beweislast bei dem Patienten, da in diesem Fall aber i. d. R. keine Befunde vorliegen, um dem Arzt den Fehler nachweisen zu können, kommt es häufig zu einer sog. Beweislastumkehr zulasten des Arztes. Dann muss dieser beweisen, dass der Schaden, den der Patient erlitten hat, auch dann eingetreten wäre, wenn der Befund korrekt erhoben worden wäre. Dies ist i. d. R. in der Beweisführung kaum zu leisten.
Der grobe Diagnosefehler und der grobe Befunderhebungsfehler haben zwei Gemeinsamkeiten: Zum einen liegt bei beiden vor Gericht die erwähnte Beweislast automatisch beim behandelnden Arzt, was für ihn die Chancen, vor Gericht zu gewinnen, erheblich verringert. Zum anderen wird bei beiden der aktuelle Facharztstandard zur Beurteilung angewendet: Ist die gestellte Diagnose unvertretbar, da sie nicht der gültigen Lehrmeinung und den Leitlinien entspricht, liegt ein grober Diagnosefehler vor. Dies ist z. B. der Fall, wenn bei einem Patienten, der nach einem Sturz über starke Schmerzen im Oberarm klagt, eine Fraktur im Röntgenbild nicht erkannt wird und eine zielführende Behandlung damit unterbleibt. Auch bei einem Patienten, bei dem trotz offensichtlicher Notwendigkeit und nach aktuellem Facharztstandard die Befunderhebung ganz unterbleibt, liegt ein sogenanntes standardunterschreitendes Verhalten vor [1].<italic/>
Für gängige Leitsymptome ist daher zu überlegen, ob in der Praxis feste Algorithmen und Diagnoseschemata erstellt werden können, die regelmäßig entsprechend den aktuellen Leitlinien überarbeitet werden. Und wenn auch das ärztliche Handeln regelmäßig hinterfragt und mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards abgeglichen wird, kann dem standardunterschreitenden Verhalten und damit Fehlern bei Diagnose und Befundung gut vorgebeugt werden.
Yvonne Schönfelder
1. Große Feldhaus S (2019): Diagnose- und Befunderhebungsfehler. In: Große Feldhaus S, Große Feldhaus J (Hrsg.) Arzt und Recht bei Fehlern und Irrtümern – Für Praxis, Klinik und Begutachtung. München: Urban & Fischer in Elsevier, S. 56–69
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2019; 41 (20) Seite 62-64
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.
