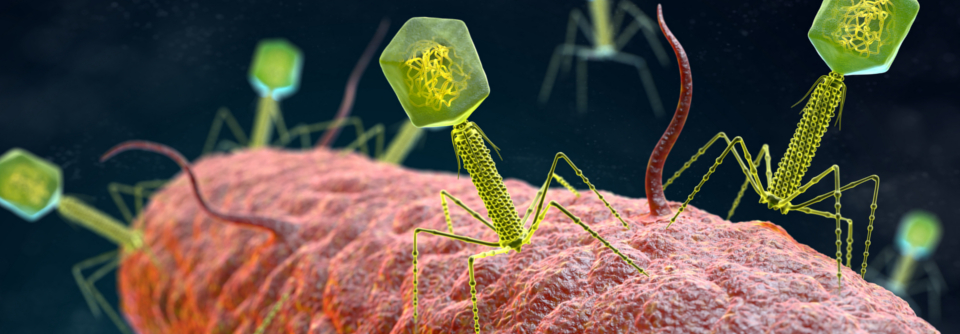Lotsen für den DFS-Versorgungsdschungel Das Symposium der AG Diabetischer Fuß zeigt dem Diabetesteam Wege auf
 Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) und die Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) seien unter bestimmten Voraussetzungen gemäß G-BA-Beschlüssen verordnungsfähig.
© Paweł Kacperek - stock.adobe.com
Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) und die Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) seien unter bestimmten Voraussetzungen gemäß G-BA-Beschlüssen verordnungsfähig.
© Paweł Kacperek - stock.adobe.com
Zu den neueren Methoden der lokalen Wundtherapie, die über Druckentlastung und weitere Standards hinausgehen, gibt es nur wenige verblindete RCTs. „Die Hypes um so manche Methode sind auf der Basis der Studienlage nicht gerechtfertigt“, meinte Dr. Florian Thienel, Quakenbrück. So könne der Einsatz eines autologen Fibrin-Patches zwar leitliniengerecht „nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Standardbehandlung ohne Abheilungserfolg“ erwogen werden. Für autologe Leukozyten/Thrombozyten/Fibrin-Patches und synthetischen Hautersatz (Amnion/Chorion-Membranen) seien aber momentan weder die Verfügbarkeit in Deutschland noch die Kostenerstattung geklärt.
Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) und die Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) seien unter bestimmten Voraussetzungen gemäß G-BA-Beschlüssen verordnungsfähig. Dies sei für Kaltplasma (CPT) und die topische Sauerstofftherapie noch nicht möglich. Dr. Thienel erachtet deren Anwendung derzeit nur in Studien als sinnvoll, um Evidenz zu generieren. Bei der Wundabdeckung mit Fischhaut reichen ihm die Ergebnisse der ersten gefäßchirurgischen Studie nicht aus, zumal er die Therapiefinanzierung auch für diese Methode als kritisch ansieht.
Wichtig: ein präziser Verordnungstext
Am 21.04.2024 wurde die neue Risikogruppeneinteilung beim Diabetischen Fußsyndrom (DFS) und bei analogen Neuro-Angio-Arthropathien von der AG Diabetischer Fuß der DDG und dem Beratungsausschuss der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) für Orthopädieschuhtechnik verabschiedet.
Mit der Schuh- und Einlagenverordnung kennt sich der Kölner Orthopädieschuhmachermeister Leo Lelgemann aus. Es sei sehr wichtig, dass die Risikogruppen „von der Diagnose und der Verordnung gestützt werden“. Wie Lelgemann erklärte, ist die Risikogruppe 2a durch das Vorliegen einer Polyneuropathie (PNP)/peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK), nicht durch den Fußzustand gekennzeichnet. Betroffene erhalten eine schuhtechnische Regelversorgung durch für DFS geeignete Schuhe und ggf. Einlagen.
Die Risikogruppen „verlaufen nicht chronologisch“, so Lelgemann, „ab Risikogruppe 2b sprechen wir von einem DFS“, also einem Risikofuß, bedingt durch PNP/PAVK und zusätzliche Faktoren. Lelgemann betonte, wie bedeutend die Angabe der Zusatzkriterien ist, damit die Genehmigung durch die Krankenkasse ihren Gang nehmen kann. Als Beispiel beschrieb er Risikogruppe 4, den Risikofuß durch PNP/PAVK und Disproportion/Deformität. Hier gelte es, bei der Diagnose die konkrete Fuß-/Zehenfehlstellung anzugeben.
Risikogruppe 7 wurde in vier Untergruppen aufgeteilt. Neben Ruhigstellung und Entlastung richte sich die individuelle Auswahl der Hilfsmittel nach den Empfehlungen der IWGDF-Leitlinien. „Und, ganz wichtig, den Gegenausgleich nicht vergessen“, sagte Lelgemann. Für Risikogruppe 3 (Z. n. Ulkus) sollte die Ulkus-Lokalisation exakt angegeben werden. Denn: Patient*innen könnten aufgrund von Sprachbarrieren oder anderen Ursachen oft nicht genau genug beschreiben, was vorgefallen sei. Für die Risikogruppen 2 (a/b), 4 und 7 gebe es eine klare Empfehlung für die Regelversorgung. Dagegen bleibe für die Gruppen 3, 5 und 6 ein „Interpretationsspielraum“.
Quelle: Diabetes Herbsttagung 2024