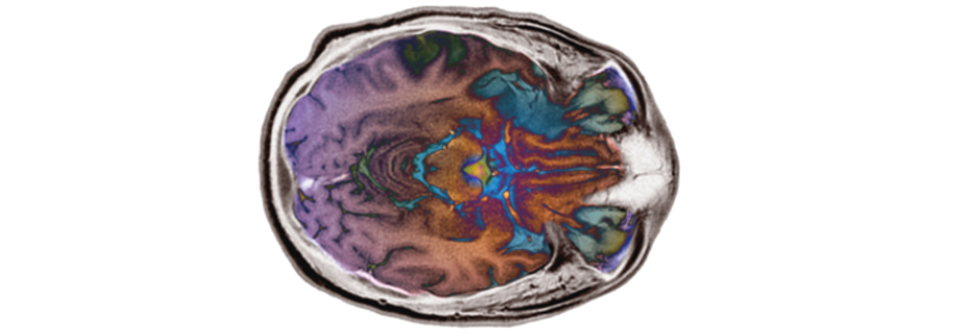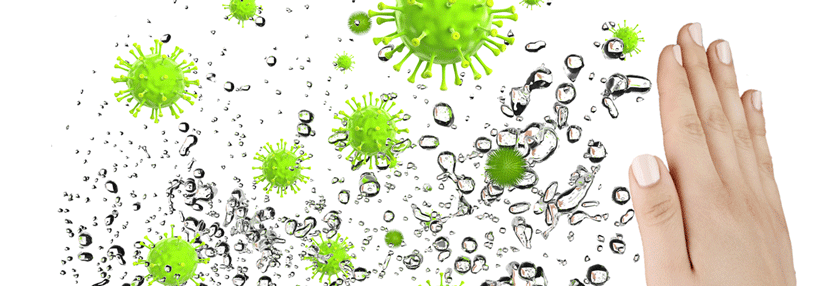Therapieren und therapiert werden Die Erfahrungen einer Psychiaterin mit der eigenen psychischen Erkrankung
 Mit großer Offenheit beschreibt sie in ihrem Buch die manischen Zustände ebenso wie ihre depressiven Phasen sowie die Rückschläge.
© melita – stock.adobe.com
Mit großer Offenheit beschreibt sie in ihrem Buch die manischen Zustände ebenso wie ihre depressiven Phasen sowie die Rückschläge.
© melita – stock.adobe.com
Schon als Kind und Jugendliche erlebt Astrid Freisen starke Stimmungsschwankungen. Im Medizinstudium kündigt sich die bipolare Störung dann allmählich konkreter an – mit depressiven Phasen im Winter und Hochs in den Sommern. Wegen der Depression sucht sie Hilfe, in einem frühen Arztbrief steht bereits die Diagnose „bipolare Störung“. Das aber verdrängt Astrid Freisen. Mit einer Depression kann sie leben, mit der Bipolarität nicht.
Dazu kommt 2006 ein ganz anderer Schock: Sie erkrankt an Multipler Sklerose. Wenige Jahre später, im Jahr 2010, bricht schließlich alles zusammen, als die Ärztin in eine heftige Manie rutscht. Sie betrügt ihren Mann, nimmt Drogen und brettert mit völlig überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahnen. Schließlich muss sie sich den Tatsachen – und der Diagnose ihrer bipolaren Störung – stellen. Sie outet sich, auch im Beruf. Und sie lernt, mit der Krankheit zu leben. Vor allem schafft sie es, Hilfe anzunehmen. 2014 gründet sie dann die „Selbst Betroffenen Profis“, eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen mit bipolarer Störung, die Erkrankten aus den psychosozialen Berufen Unterstützung anbietet. Nach 15 Jahren in deutschen Kliniken geht Astrid Freisen 2021 nach Island, wo sie heute an der Universitätsklinik Reykjavik arbeitet.
Medizinischer Hintergrund wird anschaulich erklärt
Mit großer Offenheit beschreibt sie in ihrem Buch die manischen Zustände ebenso wie ihre depressiven Phasen sowie die Rückschläge, die sie mit und durch ihre MS erlebt. Ihre Geschichte ergänzt sie durch gut verständliche Texte zu den medizinischen Hintergründen. Das Ganze ist flüssig geschrieben und mit einer Prise Humor gewürzt. Insgesamt ein sehr lesenswertes Buch – für Betroffene, Behandelnde und Laien.
Wie geht es Ihnen aktuell?
Es geht mir sehr gut, ich bin medikamentös stabil eingestellt, sowohl mit Blick auf die bipolare Störung als auch hinsichtlich der MS. Ich war im letzten Winter kurz wieder in einer schlechten, d. h. depressiven Phase. Das habe ich aber früh wahrgenommen, mich sofort zurückgezogen und um mich gekümmert. So bin ich innerhalb von zwei Wochen wieder aus dem Tief herausgekommen.
Wie ist Ihr Buch angekommen?
Das Buch wurde von denen, die es gelesen haben, sehr gut aufgenommen. Insgesamt hat es aber weniger Verbreitung gefunden, als ich gehofft hatte. Die bipolare Störung bleibt eben doch ein Nischenthema.
Gibt es Pläne für ein weiteres Buch?
Ich würde als Nächstes gerne einen Sammelband mit Erfahrungsberichten selbst betroffener Profis herausbringen, eventuell auch mit anderen Krankheitsbildern. Aber konkrete Pläne dafür gibt es noch nicht.
Wie läuft es beruflich in Island?
Sehr gut! Der Umzug hierhin war gleichbedeutend mit einem regelrechten Karrieresprung. Ich kann viel mehr Verantwortung übernehmen als in Deutschland. Aktuell leite ich das Team für behandlungsresistente Depressionen, das unter anderem Ketaminbehandlungen und Elektrokonvulsionstherapien anbietet. Zudem arbeite ich im Bipolar-Team mit, das Menschen mit bipolarer Störung ambulant behandelt.
Dazu kommt eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien. Und ich habe weiterhin meine klar geregelten Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr ohne Nacht- und Wochenenddienste. Wobei das nicht-diensthabende Kollegium in der Regel genauso pünktlich gehen kann. Überstunden sind anders als in Deutschland selten nötig und hier auch nicht gerne gesehen.
Zum Thema Stigmatisierung: Wie geht man in Island mit psychischen Erkrankungen um?
Die Hemmschwelle ist in Island noch höher als in Deutschland, sich Hilfe zu holen, nach dem Motto: Ein Wikinger macht das mit sich selbst aus. Aber es ist spannend, daran mitarbeiten zu können, diese Krankheiten zu entstigmatisieren.
Kommunizieren Sie Ihre Krankheit am Arbeitsplatz oder bei Bekannten?
Island hat knapp 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner, da kennt eigentlich jeder jeden. Da ich auch hier mit meiner bipolaren Störung offen umgehe und zwei große Interviews mit mir veröffentlicht wurden, hat sich meine bipolare Störung inzwischen rumgesprochen. Über die MS spreche ich weniger offen, auch weil sie in meinem Alltag eine kleinere Rolle spielt.
Wie ist das Leben in Island?
Man lebt hier mehr mit und in der Natur als in Deutschland, wird ihr gegenüber demütiger. Und das Wetter spielt eine deutlich größere Rolle, denn es kann einen natürlich auch mal völlig ausbremsen. Wenn z. B. eine Sturmwarnung kommt, bleibt man daheim und versucht nicht etwa, mit allen Mitteln an den Arbeitsplatz zu kommen. Insgesamt fühle ich mich hier viel entspannter als zu Hause.
Vermissen Sie Deutschland?
Manchmal fehlt mir der Austausch mit Angehörigen oder Freundinnen und Freunden, vor allem in der Muttersprache. Ich lerne zwar Isländisch und kann mich auch im Alltag inzwischen gut verständigen. Für Gespräche mit Patientinnen und Patienten reicht das aber nicht aus, die führe ich auf Englisch. Das ist aber völlig in Ordnung, die Menschen hier sprechen alle ausgezeichnet Englisch. Und in der Klinik sind wir ohnehin ein bunt gemischtes Völkchen. Rund 20 % des Krankenhauspersonals haben nicht-isländische Wurzeln. Das Land ist bei Einwandernden unter anderem deshalb beliebt, weil es sehr LGBTQ-freundlich ist.
Wie läuft es bei der von Ihnen gegründeten Selbsthilfegruppe ,„Selbst Betroffene Profis“?
Es läuft sehr gut. Wir haben 2020, noch vor COVID, Zoom-Gruppen ins Leben gerufen, in denen man sich über die eigenen Erfahrungen austauschen kann, also quasi virtuelle Selbsthilfegruppen. Das kommt sehr gut an, aktuell nehmen daran in acht Gruppen etwa 80 Personen teil. Und mir fällt auf, dass die Jüngeren schon ganz anders mit der Krankheit umgehen, sie haben ein sehr viel größeres Selbstverständnis. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung.
Ich selbst hatte mich in der Gruppe zwischenzeitlich nach meiner Ankunft hier ein wenig rarer gemacht und die Leitung abgegeben. Seit letztem Jahr bin ich wieder aktiver und teile mir jetzt die Leitung mit einer Pflegefachkraft.
Interview: Dr. Anja Braunwarth