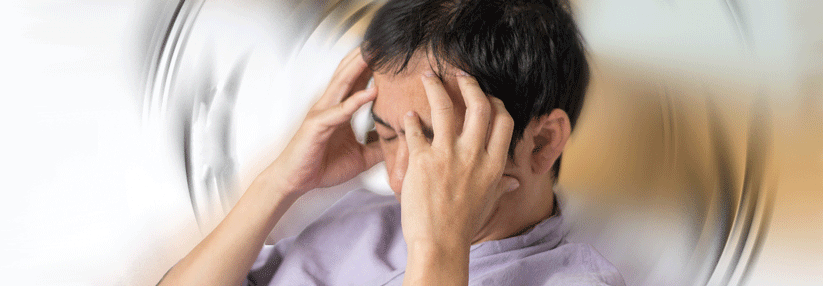
Vestibuläre Störungen Die vielen Gesichter des Schwindels
 Wie identifiziert man die wichtigsten Formen des Schwindels?
© 桐生千鶴 - stock.adobe.com
Wie identifiziert man die wichtigsten Formen des Schwindels?
© 桐生千鶴 - stock.adobe.com
Lagerungsschwindel
Mit einem Anteil von 24 % dominiert unter den vestibulären Störungen der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel (BPLS). Ihn kennzeichnen bewegungsabhängige Drehschwindelattacken, die weniger als eine Minute andauern. Die Symptome beginnen häufig im Bett, wenn sich die Patientinnen und Patienten hinlegen, auf den Rücken drehen oder den Kopf reklinieren. Betroffen sind insbesondere Frauen über 40 Jahre, erinnerte Prof. Dr. Frank Schmäl, Zentrum für HNO, Münster.
Bei Älteren mit Gleichgewichtsstörungen kann das Schwindelgefühl allerdings gänzlich fehlen, wie eine aktuelle Studie zeigt. Darin erhielten 618 sturzgefährdete oder gestürzte Personen im Durchschnittsalter von 77 Jahren eine BPLS-Diagnostik. Immerhin ein Viertel der positiv Getesteten verspürte bei der Lagerungsprüfung keinen Schwindel, betonte der Kollege. Auch ohne typische Symptome sollte man bei dieser Patientengruppe daher immer einen BPLS ausschließen.
Interessanterweise geht ein Lagerungsschwindel mit einem im Vergleich zu Gesunden niedrigeren Vitamin-D-Spiegel einher, erklärte Prof. Schmäl. Sofern ein Mangel besteht, eignet sich eine Substitution des Mikronährstoffs nachweislich zur Rezidivprophylaxe. Grundsätzlich liegt die Rezidivrate des BPLS nach fünf Jahren bei bis zu 50 %.
Vestibuläre Migräne
Die vestibuläre Migräne macht 12 % aller Schwindelerkrankungen aus. Um die Diagnose stellen zu können, müssen sich fünf oder mehr Attacken mit milden bis schweren vestibulären Symptomen ereignet haben. Diese Attacken dauern definitionsgemäß zwischen fünf Minuten und 72 Stunden. Als weiteres Kriterium gilt eine aktuelle oder frühere Migräne. Zudem muss bei der Hälfte der Schwindelepisoden mindestens ein Migränesymptom (charakteristische Kopfschmerzen, Licht- oder Geräuschempfindlichkeit, visuelle Aura) aufgetreten sein.
Der Schwindel selbst kann sich vielfältig äußern. Betroffene berichten über eine gestörte räumliche Orientierung oder ein falsches Bewegungsgefühl (68 %), bemerken eine Eigenbewegung, obwohl diese nicht stattfindet (59 %), oder denken, dass sich die visuelle Umgebung bewegt (52 %). Unter cochleären Symptomen wie Tinnitus, Ohrdruck und Hörverlust leidet bis zu jede bzw. jeder Dritte.
Anhand der beschriebenen Beschwerden während der Schwindelepisoden konnten im Rahmen einer Studie fünf Cluster gebildet werden:
- längere Dauer der Schwindelanfälle (> 24 Stunden; 9,4 %)
- keine Kopfschmerzen und keine cochleären Symptome (21,3 %)
- keine Kopfschmerzen, aber cochleäre Symptome (18 %)
- Kopfschmerzen und cochleäre Symptome (23,4 %)
- Kopfschmerzen, aber keine cochleären Symptome (27,9 %)
Morbus Menière
Der Morbus Menière, der bei 11 % der Patientinnen und Patienten mit Schwindelsyndrom vorliegt, weist einige Parallelen zur vestibulären Migräne auf. Als pathophysiologisches Korrelat wird der endolymphatische Hydrops angesehen. Dieser findet sich laut einer MRT-Analyse bei 80 % der Menière-Betroffenen, aber auch bei 32 % derjenigen mit vestibulärer Migräne, sagte Prof. Schmäl. Zudem überlappen sich Symptome wie Anfallsdauer und Ohrbeschwerden. Daher wundert es nicht, dass in einer aktuellen Publikation postuliert wird, der Morbus Menière sei eine Sonderform der vestibulären Migräne.
Die Schwindelepisoden halten typischerweise 20 Minuten bis zwölf Stunden an und werden von fluktuierenden cochleären Symptomen begleitet (Tinnitus, Druckgefühl, Hörminderung). Patientinnen und Patienten erleben eine Hörminderung im Tiefton- bis Mitteltonbereich, auch wenn sie diese dem Referenten zufolge mitunter nicht wahrnehmen. Für die Menière-Diagnose muss die Hörminderung bei wenigstens einer audiometrischen Untersuchung vor, während oder nach einer Attacke nachgewiesen werden.
Vestibuläre Paroxysmie
Als vergleichsweise seltenes Syndrom tritt die vestibuläre Paroxysmie in 4 % der Fälle auf. Ihr liegt eine Störung des N. vestibulocochlearis in Form eines Gefäß-Nerven-Kontakts zugrunde. Mindestens zehn spontan auftretende Schwindelattacken, die weniger als eine Minute andauern, kennzeichnen diese Form. „Wichtig ist, dass es sich um häufig wiederkehrende Attacken und nicht um Dauerschwindel handelt“, fügte Prof. Schmäl hinzu. Beim betroffenen Individuum äußern sich die Symptome immer gleich.
Begleitend kommt es gelegentlich zu einem pulssynchronen oder Schreibmaschinentinnitus, einem Kopfschüttelnystagmus oder zu Lagerungsnystagmen (ausgelöst durch BPLS-untypische Kopfbewegungen). Zu den Diagnosekriterien zählt auch eine Besserung der Beschwerden nach Gabe eines Natriumkanalblockers in adäquater Dosis.
Funktioneller Schwindel
Jede bzw. jeder Zehnte mit vestibulärer Störung leidet unter einem funktionellen Schwindel. Früher bezeichnete man diese Form als phobischen Schwankschwindel, inzwischen etabliert sich der Name persistierender postural-perzeptiver Schwindel (PPPD*). Patientinnen und Patienten empfinden ständig ein Schwanken, was im Alltag zu einer erheblichen funktionellen Beeinträchtigung führt. Eine aufrechte Körperhaltung und aktive oder passive Bewegung, z. B. im Auto oder Fahrstuhl, verstärken die Symptomatik. Gleiches gilt für komplexe visuelle Muster (Supermarktregale, Straßenpflasterungen) und bewegliche Reize (Straßenverkehr, Fernsehen).
Während sich beim primären PPPD keine somatische Ursache findet, geht dem sekundären eine organische Störung wie unilaterale Vestibulopathie oder Morbus Menière voraus. Die sekundär Betroffenen sind einer Studie zufolge signifikant älter als diejenigen mit primärem postural-perzeptivem Schwindel. Häufiger Auslöser ist ein benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Prof. Schmäl hält daher eine rasche Diagnose und Therapie des Lagerungsschwindels für wichtig, um einen sekundären PPPD zu vermeiden.
* persistent postural-perceptual dizziness
Quelle: 18. HNO-Update-Seminar


