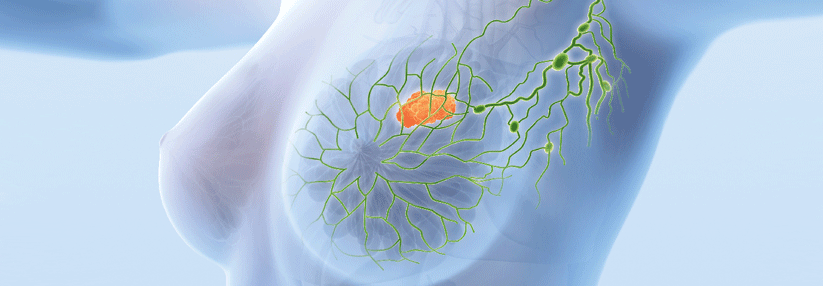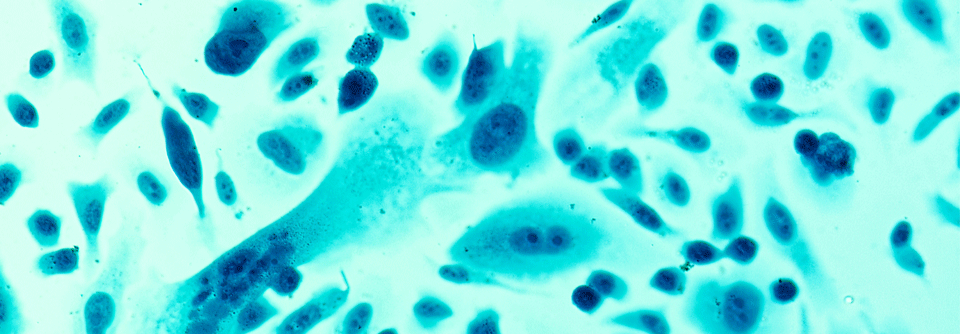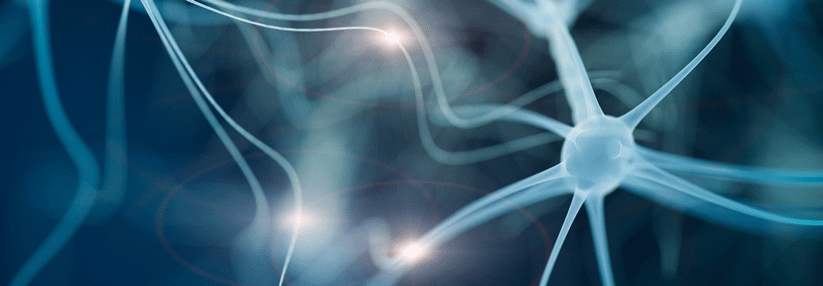Immunvermittelte Kolitis Extrakorporale Photopherese gegen Nebenwirkungen von CPI
 Erste Daten zeigen, dass schwere immunvermittelte Toxizitäten nach CPI durch ECP behandelbar sind.
© Studio Romantic – stock.adobe.com
Erste Daten zeigen, dass schwere immunvermittelte Toxizitäten nach CPI durch ECP behandelbar sind.
© Studio Romantic – stock.adobe.com
Immuntherapien gehen mit Toxizitäten einher, die manchmal schwer genug ausfallen, um einen Abbruch der Behandlung zu erzwingen. Wissenschaftler:innen aus Freiburg und Baltimore gelang es nun, diese unerwünschten Folgen durch eine extrakorporale Photopherese (ECP) deutlich zu lindern.
Bei dem Verfahren werden den Betroffenen Immunzellen entnommen, u. a. mit UV-Strahlung behandelt und reinfundiert. Im Anschluss vermitteln diese antientzündliche Signale. Bisher kam die ECP vor allem in der Transplantationsmedizin zum Einsatz, beispielsweise gegen eine Graft-versus-Host-Erkrankung.
ECP stoppt Immuntherapie-Nebenwirkungen
In der neuen Studie erprobten die Forschenden die ECP bei 14 mit Checkpointinhibitoren behandelten Patient:innen, die an schweren immunvermittelten Nebenwirkungen litten und glukokortikoidrefraktär waren. Alle von ihnen konnten die Steroiddosis reduzieren und 92 % zeigten nach zwölf Wochen ein klinisches Ansprechen. Eine immunbedingte Kolitis heilte in sämtlichen Fällen vollständig aus (organspezifische klinische CR-Rate 100 %).
„Wir konnten die Nebenwirkungen der Krebs-Immuntherapie weitestgehend stoppen. Besonders spannend ist, dass darunter die Abwehr gegen den Krebs nicht leidet. Das hebt die Lebensqualität der Krebspatient:innen deutlich“, bilanzierte Prof. Dr. Robert Zeiser, Universitätsklinikum Freiburg. Sein Kollege Prof. Dr. Justus Duyster ergänzte, dass auf diese Weise eventuell auch viele Erkrankte von CPI profitieren können, für die sich diese Behandlung bisher zu belastend gestaltet.
Quelle:
Braun LM et al. Cancer Cell 2025; 43(2): 269–291.e19; DOI: 10.1016/j.ccell.2025.01.004