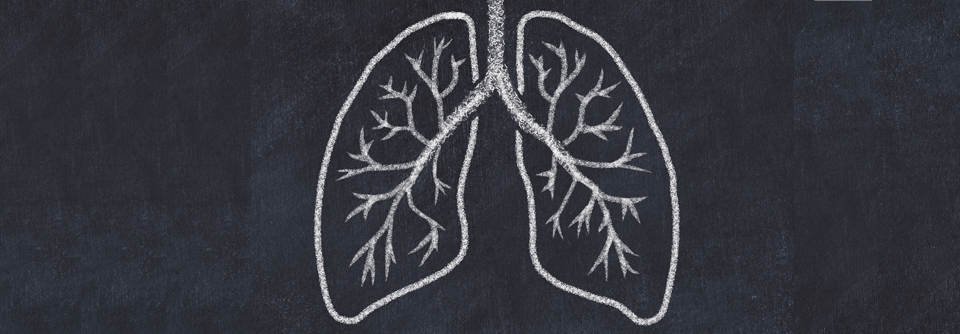Belastetes Innenraumklima Feuchtigkeit und Schimmel könnten Asthma begünstigen
 Mit Wegwischen ist es nicht getan. Um weiterem Schimmelbewuchs vorzubeugen, sollte man zusätzlich lüften.
© FotoDuets/gettyimages
Mit Wegwischen ist es nicht getan. Um weiterem Schimmelbewuchs vorzubeugen, sollte man zusätzlich lüften.
© FotoDuets/gettyimages
Dass Luftschadstoffe in Innenräumen Auswirkungen vor allem auf die pulmonale Gesundheit haben können, liegt auf der Hand. Moderne Isolations- und Wärmedämmungsmaßnahmen begrenzen obendrein den Luftaustausch zwischen drinnen und draußen und intensivieren so die Exposition.
Nahezu überall finden sich Rückstände von Reinigungs- und Waschmitteln (z. B. Benzalkoniumchlorid, Natriumhypochlorit, Ammonium- und Natriumhydroxid) im Hausstaub. Volatile organische Verbindungen (VOC) wie Benzol, Toluol, Ethylbenzol und die Xylole in der Raumluft stammen aus Lösungsmitteln, Klebstoffen, Wandfarbe und Politur. Auch Pestizide, die zum Schutz von Zimmerpflanzen oder gegen Ungeziefer zum Einsatz kommen, gelangen in den Atemtrakt und können am bronchialen Epithel Schaden anrichten. Ein weiterer Risikofaktor ist Feuchtigkeit, die sich bei mangelndem Luftaustausch im häuslichen Bereich niederschlägt und die Schimmelbildung fördert. Schon seit Längerem weiß man, dass Kinder, die früh im Leben gegenüber Schimmelpilzen exponiert sind, ein erhöhtes Risiko für eine Sensibilisierung und die Entwicklung eines Asthmas haben.
Inflammation und oxidativer Stress spielen eine Rolle
Die Mechanismen, die zu einer Schädigung der Atemwege führen, sind vielfältig und reichen von der Störung der epithelialen Barriere oder des Mikrobioms bis zur epigenetischen oder metabolischen Umprogrammierung. Eine Rolle spielen auch oxidativer Stress und Inflammation sowie eine Dysregulation des Immunsystems.
Für die EAACI*-Leitlinie nahm eine Autorengruppe um Prof. Dr. Ioana Agache von der Transylvania University in Brasov Studien genauer unter die Lupe, in denen es um die Zusammenhänge zwischen Reinigungsmitteln, flüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, Feuchtigkeit/Schimmel und der Entwicklung bzw. Symptomatik von Asthma ging.
Insgesamt fand sich nur eine schwache bis sehr schwache Evidenz für einen Zusammenhang zwischen einer Exposition gegenüber VOC und der Entstehung oder Verschlechterung von Asthma. Lediglich für Formaldehyd ergab sich eine gewisse Assoziation zu neu aufgetretenem Giemen und einer geringen Abnahme der Lungenfunktion. Auch das Ausmaß der Schadstoffexposition war leicht mit der Schwere der Asthmasymptome korreliert.
Personen, die beruflich Umgang mit Reinigungsmitteln haben (z. B. Pflegepersonal, Putzkräfte) scheinen ein eher geringes Risiko für das Neuauftreten eines Asthmas zu haben. Eine Exposition kann allerdings bestehende Asthmasymptome verschlimmern, wobei der Evidenzgrad dafür niedrig ist. Der Einfluss auf die Lungenfunktion war uneindeutig.
Auswirkungen einer Pestizidexposition in Innenräumen auf das Risiko, ein Asthma zu entwickeln, konnten nicht gesichert belegt werden. Auch hinsichtlich einer etwaigen Abnahme der Lungenfunktion wurde kein signifikanter Zusammenhang festgestellt. Eine Assoziation zwischen der Innenluftbelastung mit Standardpestiziden und einer bestehenden Asthmasymptomatik ließ sich nur mit geringer Sicherheit bestätigen.
Lediglich in Bezug auf Schimmel und Feuchtigkeit ergab sich eine moderate Evidenz dafür, dass eine Exposition die Entwicklung eines neuen Asthmas begünstigt. Deutlich schwächer fiel dagegen die Assoziation zwischen Feuchtigkeits- und Schimmelexposition und einem erhöhten Risiko für Asthmaexazerbationen und die Verschlechterung von Symptomen beziehungsweise der Krankheitskontrolle aus.
Trotz der eher dünnen Evidenzlage wird in der Leitlinie empfohlen, die Schadstoffexposition in Innenräumen beim Asthmamanagement zu berücksichtigen. Besonders wichtig ist das für vulnerable Gruppen wie Kinder, Schwangere und ältere Menschen mit Komorbiditäten, betont das Autorenteam.
Luftfilter können helfen, die Belastung zu reduzieren
Die individuelle Exposition gegenüber den genannten Substanzen lässt sich grob einschätzen, indem man den Schadstoffgehalt in Luft und Hausstaub analysiert und relevante Biomarker in Speichel oder Urin bestimmt. Um die Belastung so gering wie möglich zu halten, ist auf eine gute Belüftung zu achten. Ggf. empfiehlt sich die Nutzung von Luftfiltern.Dr. Angelika Bischoff
* European Academy of Allergy and Clinical Immunology
Quelle: Agache I et al. Allergy 2025; 80: 651-676; DOI: 10.1111/all.16502