
Sex ohne Grenzen Für „Sexsucht“ gibt es demnächst eine neue diagnostische Zuordnung
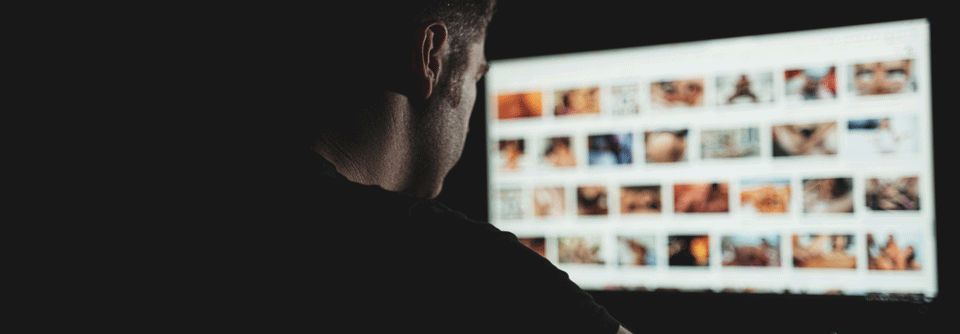 Psychotherapie und ggf. Medikamente helfen dabei, zu einem gesunden Umgang mit Sexualität zurückzufinden.
© M-Production - stock.adobe.com
Psychotherapie und ggf. Medikamente helfen dabei, zu einem gesunden Umgang mit Sexualität zurückzufinden.
© M-Production - stock.adobe.com
Die mangelnde Fähigkeit zur sexuellen Selbstkontrolle– oft auch „Sexsucht“ genannt– wurde bislang in der ICD-10 in der Regel als „gesteigertes sexuelles Verlangen“ oder eine nicht näher definierte sexuelle Funktionsstörung kodiert. In der ICD-11 gibt es mit der „Compulsive Sexual Behaviour Disorder“ (CSBD) dafür nun eine eigene Diagnose, und zwar im Kapitel der Impulskontrollstörungen. Die deutsche Übersetzung lautet in der Entwurfsfassung „zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung“. Die Diskussion über die Begrifflichkeit sei aber noch nicht abgeschlossen, erklärte Prof. Dr. Peer- Briken- vom Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die aktualisierten Diagnosekriterien sollen auch dazu beitragen, einer übermäßigen Pathologisierung vorzubeugen.
Wichtig für die Diagnose CSBD ist ein anhaltendes Muster des Unvermögens, sexuelle Impulse und Triebe zu kontrollieren, was zu einem repetitiven Sexualverhalten führt. Dieses muss sich über sechs Monate zeigen. Weitere Kriterien sind:
- Die sexuellen Aktivitäten rücken derart in den Mittelpunkt des Lebens, dass Gesundheit, Hygiene oder andere Interessen und Verantwortlichkeiten vernachlässigt werden.
- Es gibt zahlreiche erfolglose Bemühungen, das Sexualverhalten zu reduzieren.
- Das Verhalten wird fortgeführt, obwohl negative Konsequenzen auftreten und obwohl nur noch wenig bis keine sexuelle Befriedigung erfolgt.
- Die mangelnde Kontrolle über das Sexualverhalten verursacht einen ausgeprägten Leidensdruck und bedeutsame Beeinträchtigungen (z. B. persönlicher, familiärer oder beruflicher Art).
Ein genereller Leidensdruck, der durch moralische Auffassungen oder aus einer Ablehnung der eigenen sexuellen Impulse und Verhaltensweisen entsteht, genügt nicht. Dieses Kriterium soll laut Prof. Briken einer allgemeinen Pathologisierung von ausschweifendem sexuellen Verhalten entgegenwirken– problematisch ist demnach nur die mangelnde Fähigkeit, sein eigenes Verhalten im gewünschten Umfang zu kontrollieren.
Wichtig in der Anamnese sind vor allem sexuelle Praktiken, Wünsche und Fantasien, ein schneller Wechsel der Sexualpartnerinnen und -partner, häufige Masturbation und ein hoher Pornografiekonsum. Ein gutes Diagnoseinstrument ist laut Prof. Briken die Compulsive Sexual Behaviour Disorder Scale, die auch auf Deutsch verfügbar ist. Die Prävalenz der Störung gab er für Männer in Deutschland mit 3 % an, für Frauen mit 2 %. Aus den USA gibt es Zahlen von 10% bzw. 7%.
Sowohl edukativ als auch therapeutisch relevant ist das sogenannte duale Kontrollmodell. Auf der einen Seite stehen Probleme der sexuellen Selbstkontrolle, die durch persönliche und Umgebungsfaktoren beeinflusst werden– darunter die einfache Verfügbarkeit von Pornografie, eine reduzierte Hemmung durch vermindertes Serotonin oder psychiatrische Komorbiditäten wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, Substanzgebrauchsstörung und Paraphilien. Auf der anderen Seite steht Sex als Coping-Strategie, die bei Dysphorie, Stress oder Ängsten zum Einsatz kommt, was sich über das Belohnungsnetzwerk verstärken kann.
In der Therapie soll die Selbstkontrolle gesteigert und Sex zu einer Ressource umfunktioniert werden. Die Einschränkung des Zugangs zu bestimmten Reizen ist laut Prof. Briken ein Behandlungsziel erster Ordnung. Zentral ist es zudem, eine individuelle Vorstellung davon auszuarbeiten, wie eine „ungestörte“ Sexualität aussehen sollte.
Um die Faktoren zu verstehen, die zu ihren Problemen beitragen, sollten die Betroffenen durch einen selbstreflexiven Prozess geführt werden. Wichtig ist es, die eigenen Emotionen (u. a. Trauer, Angst oder Enttäuschung) zu erkennen und für diese offen zu sein. Zur Steigerung der Affekttoleranz und der Fähigkeit zur Stimmungsregulation bieten sich Psychoedukation, Achtsamkeits- und Entspannungsmethoden sowie eine kognitive Verhaltenstherapie an. Dabei sollte besprochen werden, dass Rückfälle möglich sind und was in diesem Fall zu tun ist. Ggf. kommt auch eine Dämpfung der Erregung durch Medikamente wie Sertralin oder Naltrexon in Betracht.
Gibt es Anzeichen für Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten oder Risiken für andere Personen, haben diese Probleme Vorrang vor allen anderen Therapiezielen. Dann sollte man auch an eine stationäre Krisenintervention denken, betonte Prof. Briken. Könnte eine Fremdschädigung im Spiel sein, sollte ein spezialisiertes Zentrum einbezogen werden. „Forensische Verläufe setzen ein spezifisches Know-how voraus“, betonte Prof. Briken.
Quelle: DGPPN*-Kongress 2024
*Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-heilkunde e. V.


