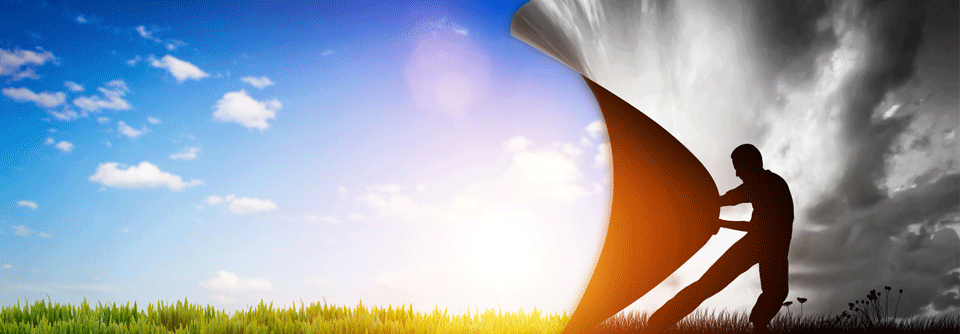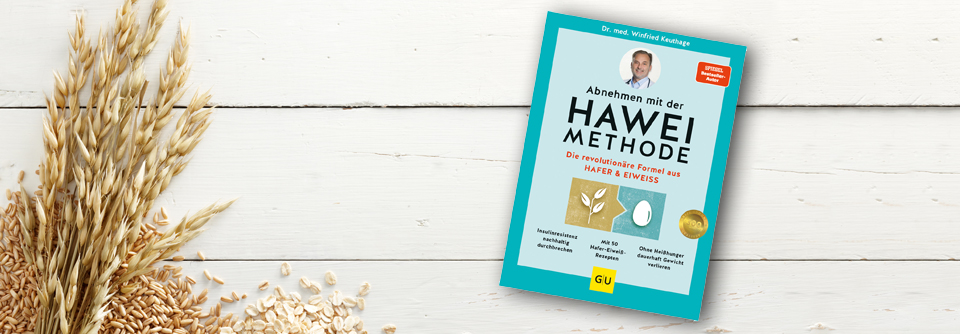
Ernährung und Depression Futter für die Seele
 Von einer ballaststoffreichen und pflanzenbasierten Ernährung profitieren Darmgesundheit und Psyche.
© KerXing – stock.adobe.com – generiert mit KI
Von einer ballaststoffreichen und pflanzenbasierten Ernährung profitieren Darmgesundheit und Psyche.
© KerXing – stock.adobe.com – generiert mit KI
Bis zum Jahr 2030 werden Depressionen laut Prognosen der Weltgesundheitsorganisation zu den weltweit häufigsten Erkrankungen zählen. Vor diesem Hintergrund ist es alarmierend, dass nur etwa ein Drittel der Betroffenen mit den derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen eine vollständige Symptomlinderung erreicht. Bis zu 40 % der Patienten, die mit Antidepressiva behandelt werden, sprechen nicht ausreichend auf die Therapie an, schreibt PD Dr. Sabrina Mörkl von der Medizinischen Universität Graz. Biopsychosoziale Ansätze, die unter anderem auch ernährungsmedizinische Aspekte berücksichtigen, könnten aus ihrer Sicht die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen künftig verbessern.
Erkrankte oft qualitativ mangelernährt
Die wechselseitige Beziehung zwischen Ernährung und Depressionen wird seit einigen Jahren intensiv erforscht. Häufig steht dabei das intestinale Mikrobiom im Fokus. Es habe sich gezeigt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen zwar nicht quantitativ, aber häufig qualitativ mangelernährt seien, so Dr. Mörkl. Ursachen dafür sind etwa der Antriebsmangel bei Depression, die Einnahme von Psychopharmaka oder ein generell gestörtes Essverhalten.
Umgekehrt kann die Ernährung die psychische Gesundheit sowohl negativ als auch positiv beeinflussen. Vor allem bestimmte Mikronährstoffe spielen eine entscheidende Rolle beim Energiestoffwechsel und bei der Synthese von Neurotransmittern. So ist für die Serotoninsynthese eine ausreichende Versorgung mit Zink, B-Vitaminen, Vitamin D und Magnesium essenziell. Zu den für die Biosynthese von Dopamin und Noradrenalin benötigten Mikronährstoffen zählen unter anderem Vitamin C, Folat und Kupfer.
Der Stoffwechsel verschiedener Neurotransmitter hängt außerdem von der Versorgung mit Makronährstoffen ab. So werden zum Beispiel mehrfach ungesättigte Fettsäuren nicht nur für die Synthese, sondern auch für die Freisetzung und die synaptische Verfügbarkeit von Dopamin und Serotonin benötigt.
Aus diesem Grund könnten ernährungsmedizinische Ansätze zumindest add on zu Antidepressiva sinnvoll sein, erklärt Dr. Mörkl. Falls eine Mangelernährung besteht, könne bei adäquater Zufuhr der fehlenden Nährstoffe möglicherweise ein zusätzlicher antidepressiver Effekt erreicht werden.
In der Tat belegen Studien, dass Ernährungsinterventionen depressive Symptome signifikant reduzieren – unabhängig von Veränderungen der körperlichen Aktivität und des Körpergewichts. Dr. Mörkl empfiehlt sowohl im Rahmen der Vorbeugung als auch der Behandlung einer Depression eine mediterrane, ballaststoffreiche und pflanzenbasierte Ernährung mit gesunden Ölen, Fisch und Meeresfrüchten sowie einen begrenzten Fleischkonsum.
Hochverarbeitete Produkte sind ungünstig
Nicht empfehlenswert scheint dagegen der Verzehr von stark verarbeiteten Lebensmitteln. In Studien fanden sich Hinweise darauf, dass diese das Risiko, eine Depression oder Angsterkrankung zu entwickeln, erhöhen.
Außerdem stehen Depressionen häufig in Zusammenhang mit Dysbalancen im Darmmikrobiom, einer gestörten Darmbarriere oder einer beeinträchtigten Funktion der Darm-Hirn-Achse. Deshalb ist der unterstützende Einsatz von Prä-, Pro- oder Synbiotika bei der Behandlung von depressiven Menschen vielversprechend. Postbiotika, vor allem bakterielle Fermentationsprodukte wie Butyrat und Propionat, wirken offenbar antiinflammatorisch.
Praktisch empfiehlt sich etwa die Integration fermentierter Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi, Joghurt oder Kefir in den Speiseplan. Auch einige Gewürze haben erwiesenermaßen mikrobiommodulierende und antidepressive Effekte. So lassen sich mit Kurkuma-Extrakt (500–1000 mg/d Curcumin) bei sehr guter Verträglichkeit deutliche Effekte auf depressive Symptome erzielen. Für Safran belegen Metaanalysen die signifikante Wirksamkeit sowohl als Mono- als auch als Add-on-Therapie bei leichter bis mittelschwerer Depression.
Auch an soziale Kontakte und Bewegung denken
Da probiotische Therapien und ernährungsmedizinische Ansätze keine schwerwiegenden Nebenwirkungen haben, könnten sie Dr. Mörkl zufolge schon jetzt standardmäßig bei Patienten mit Depressionen eingesetzt werden. Für eine umfassende biopsychosoziale Betrachtungsweise müsse man neben der Ernährung und pharmakologischen Aspekten aber den gesamten Lebensstil berücksichtigen, darunter auch soziale Kontakte und die körperliche Aktivität der Patienten.
Quelle: Mörkl S. Ernährungs Umschau 2024; 71: M28-M34; DOI: 10.4455/eu.2024.003