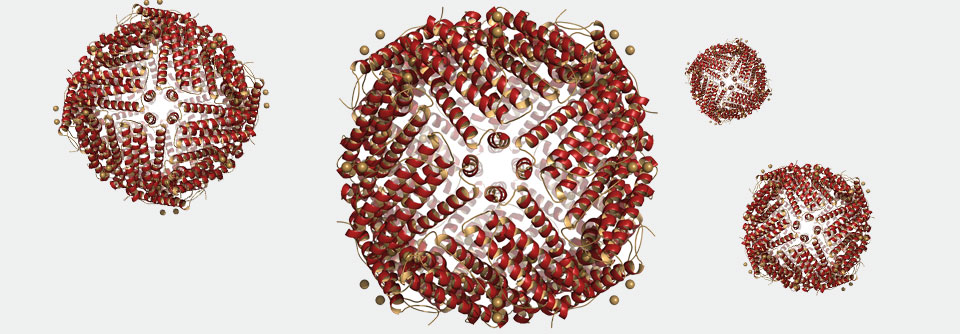Eisenmangel bei Herzinsuffizienz Mangelzustand beim Mangelzustand
 Zur Bestimmung und Behandlung des Eisenmangels ist die Transferrinsättigung unbedingt mit einzubeziehen.
© BooDogz – stock.adobe.com
Zur Bestimmung und Behandlung des Eisenmangels ist die Transferrinsättigung unbedingt mit einzubeziehen.
© BooDogz – stock.adobe.com
Ein Eisenmangel als Komorbidität der Herzinsuffizienz erhöht die Mortalität, verringert die Lebensqualität und führt zu einer stärkeren Symptomatik. Bis zu 50 % der Patienten leiden darunter. Und das Defizit muss nicht zwangsläufig von einer Anämie begleitet werden, erinnerte Prof. Dr. Michael Böhm vom Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Laut den ESC*-Leitlinien soll man jeden Herzinsuffizienten regelmäßig auf das Vorliegen eines Eisenmangels testen. Dies geschieht im Alltag jedoch selten, wie Daten aus dem dem schwedischen Herzinsuffizienzregister SwedeHF zeigen. Unabhängig von der Ejektionsfraktion erfolgt eine entsprechende Laboruntersuchung nur in ca. 25 % der Fälle. „Das wird bei uns nicht anders sein“, sagte Prof. Böhm bezogen auf die Quote in Deutschland.
Die i.v. Supplementierung mit Eisencarboxymaltose oder Eisen(III)-Derisomaltose gilt als Mittel der Wahl, um die Beschwerden zu bessern. In der Praxis sehe man aber immer wieder eine orale Therapie, bemängelte der Experte: „Das funktioniert nicht.“ Bereits 2017 ergab die IRONOUT-HF-Studie bei Patienten mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) und Eisenmangel, dass ein orales Präparat die Belastungskapazität – gemessen anhand des Peak VO2 – nicht steigert.
Anders verhält es sich bei intravenöser Gabe, wobei die positiven Effekte auf harte Endpunkte das Signifikanzniveau in den randomisierten Studien meist knapp verpassten. So fand sich in AFFIRM-AHF mit Eisencarboxymaltose zwar eine signifikante relative Risikoreduktion der Hospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz um 26 %, aber nicht im kombinierten primären Endpunkt, bestehend aus Klinikeinweisung und kardiovaskulärem Tod. Ähnlich die Ergebnisse der IRONMAN-Studie mit Eisen(III)-Derisomaltose: Eine ca. 20%ige Risikoreduktion stand grenzwertigen p-Werten gegenüber. Prof. Böhm führte die verfehlte Signifikanz u.a. auf die Kohortengrößen zurück. Die Studien zur Eisensubstitution waren mit ungefähr 1.100 Teilnehmern viermal kleiner als z.B. Untersuchungen zu Herzinsuffizienzmedikamenten, was ihm zufolge die statistische Power einschränkt.
Zahlreiche Metaanalysen sprechen ebenfalls für die i.v. Therapie, weshalb man sich im fokussierten Update der ESC-Leitlinien von 2023 dazu entschloss, die Supplementierung aufzuwerten. Bei symptomatischer HFrEF und HFmrEF** mit Eisenmangel steht nun eine Klasse-IA-Empfehlung in Bezug auf Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität (vorher IIaA). Zur Reduktion von herzinsuffizienzbedingten Hospitalisierungen gibt es eine Klasse-IIaA-Empehlung (vorher IIaB) – also ein „sollte erwogen werden“.
Oral ist nicht optimal
Eine einfache Rechnung veranschaulicht das Problem mit der oralen Eisensubstitution. So hat ein 95 kg schwerer Herzinsuffizienzpatient mit einem Serumferritin von 10 ng/ml und einem um 3 g/dl erniedrigten Hämoglobin einen Eisenbedarf von 1.200 mg. Bei optimaler Resorption (8 mg pro Tag) und 100%iger Adhärenz müsste die Supplementierung über fünf Monate laufen, um diesen Mangel auszugleichen. Allerdings geht eine Herzschwäche wie viele andere Grunderkrankungen auch mit einem inflammatorischen Zustand einher. Im Zuge dessen steigt der Hepcidin-Spiegel, was die Mobilisierung von Eisen aus Speichern und dessen Resorption im Darm hemmt, erklärte Prof. Böhm. Patienten können oral dann nur noch 1–2 mg täglich aufnehmen.
Neutrale Studie verhinderte stärkere Empfehlung
Dass eine Klasse-I-Empfehlung in puncto Klinikeinweisungen ausblieb, lag Prof. Böhm zufolge an der im letzten Jahr publizierten HEART-FID-Studie. In ihr schnitt die i.v. Supplementierung nicht besser ab als Placebo. Der mögliche Grund dafür offenbart einen anderen klinisch relevanten Aspekt der Eisentherapie. Zwar bestand mit einem mittleren Serumferritin von 56 bzw. 57 ng/ml in beiden Gruppen definitionsgemäß eine Indikation zur Behandlung. Die durchschnittliche Transferrinsättigung (TSAT) war allerdings relativ hoch (24 bzw. 23 %). Womöglich hatte die Hälfte der eingeschlossenen Patienten gar keinen echten Eisenmangel und die Autoren haben „einfach Pech gehabt“, spekulierte der Kollege. Ob das stimmt, werde derzeit ausgewertet.
Die Relevanz der Transferrinsättigung zeichnet sich auch in einer Metaanalyse ab, die den Therapieeffekt in den Studien zu Eisencarboxymaltose genauer aufschlüsselte. Demnach brachte die Supplementierung ab einer TSAT von ≥ 24 % keinen Vorteil. Ein erkennbarer Benefit trat erst bei einer Sättigung < 20 % auf.
Der gleiche Cut-off fand sich in einer großen Registerarbeit mit über 4.400 Herzinsuffizienzpatienten. Während eine TSAT < 20 % die Gesamtsterblichkeit beeinflusste, sagte ein Ferritinspiegel < 100 ng/ml nichts über das Mortalitätsrisiko. Im Gegenteil: Die schlechteste Prognose hatten diejenigen mit niedriger TSAT (< 20 %) und hohem Ferritin (≥ 300 ng/ml). Prof. Böhm erinnerte daran, dass Ferritin als Akut-Phase-Protein auch durch die Inflammation im Rahmen der Herzschwäche hochreguliert wird. Entsprechend volatil sind die Werte. „Das heißt mit anderen Worten: Das Kriterium, nach dem Sie behandeln, sollte die Transferrinsättigung sein.“
* European Society of Cardiology
** heart failure with mildly reduced ejection fraction
Quelle: Kongressbericht 19. DGK-Kardiologie-Update-Seminar