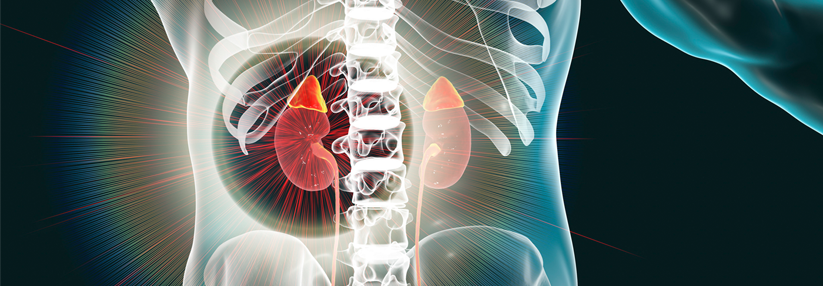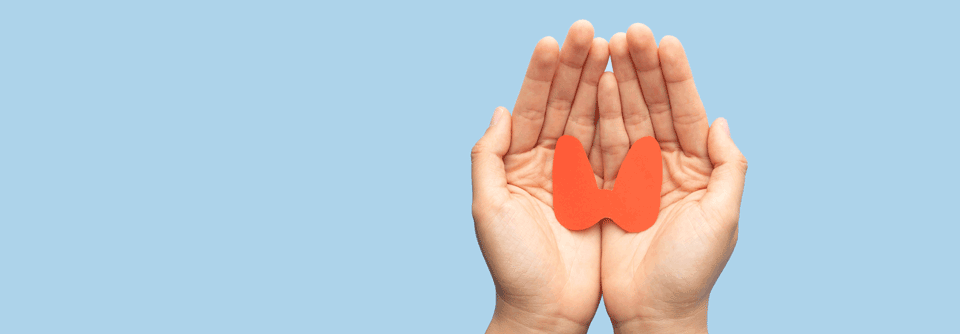Von der Hypophyse bis zur Nebenniere Neues aus der Endokrinologie
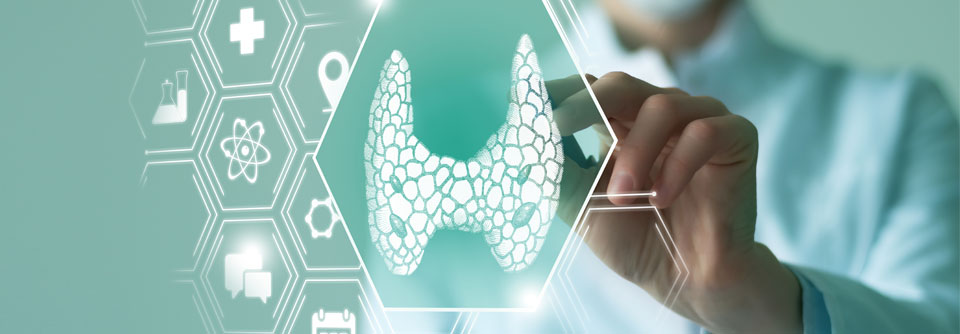 Im Bereich der Endokrinologie gibt es einige Neuigkeiten aus der Forschung.
© mi_viri – stock.adobe.com
Im Bereich der Endokrinologie gibt es einige Neuigkeiten aus der Forschung.
© mi_viri – stock.adobe.com
Prof. Dr. Martin Reincke von der Medizinischen Klinik IV am Klinikum der LMU München begann mit der Hypophyse, genauer mit dem Morbus Cushing. Er stellte Daten zu Osilodrostat vor. Das Adrenostatikum überzeugte in der Phase-III-Studie LINC 4. Primärer Endpunkt war der Anteil der Patienten nach drei Monaten mit einem freien Kortisol im Urin unter der unteren Nachweisgrenze (biochemische Remission). Dieses Ziel erreichten 77 % in der Verumgruppe gegenüber 8 % unter Placebo. Darüber hinaus besserten sich damit Blutdruck, HbA1c, HDL-Cholesterin, Gewicht und Taillenumfang. Allerdings blieb die Therapie nicht ohne Nebenwirkungen: 37 % der Patienten litten unter Appetitlosigkeit, 35 % unter Arthralgien, 33 % unter Übelkeit und über den gesamtem Studienverlauf hinweg verzeichnete man bei 15–25 % eine Nebennierenkrise.
Osilodrostat wirkt auch beim paraneoplastischen M. Cushing, wie eine andere Studie zeigte. Unter einer de novo Monotherapie normalisierte sich das Urinkortisol bei 82 % der Teilnehmer. Unter einer Zweitlinien-Monotherapie gelang das bei 100 %, durch Kombination mit anderen Substanzen bei 67 %. Allerdings entwickelte fast ein Viertel der Patienten (24 %) eine Nebenniereninsuffizienz Grad 3–4. Dennoch, für Prof. Reincke „ist die orale adrenostatische Therapie ein Gamechanger“.
Sein nächstes Thema war die Schilddrüse in der Schwangerschaft. Werdende Mütter haben einen erhöhten Hormonbedarf. Unter einer bestehenden LT4-Therapie muss man die Dosis ab der 6.–8.Schwangerschaftswoche um ca. 30 % erhöhen. Die Versorgung des Kindes mit Schilddrüsenhormonen hängt entscheidend vom maternalen LT4 ab, daher ist eine ausreichende orale Jodidsupplementierung mit 100–150 µg/d in Schwangerschaft und Stillzeit erforderlich.
Durch Einwirkung des HCG auf den TSH-Rezeptor sinkt physiologischerweise der mütterliche TSH-Spiegel, schwangerschaftsspezifische Referenzbereiche fehlen aber. Erhöhte TSH-Werte wiederum steigern das Risiko für schwangerschaftsassoziierte Komplikationen, vor allem für Aborte und Frühgeburtlichkeit. Das gilt schon ab Werten > 2,5 mU/l und besonders, wenn gleichzeitig erhöhte TPO-Antikörper vorliegen. In mehreren Studien zu unterschiedlichen Szenarien wurde untersucht, ob man euthyreote Frauen mit Schilddrüsenautoimmunität präkonzeptionell mit Hormonen behandeln sollte. Sie fielen alle negativ aus, die Gabe von LT4 verringerte weder die Abortrate nach IVF/Embryotransfer noch steigerte sie die Rate an Lebendgeburten bei Infertiliät/Abort oder nach wiederholten Aborten. Die aktuelle Empfehlung lautet daher: bei Risikopatientinnen früh das TSH bestimmen und alle 4–6 Wochen kontrollieren, ab Werten oberhalb des Referenzbereichs bzw. > 2,5 mU/l LT4 verordnen. Außerdem sollte man die Indikation für LT4 nach dem Ende der Schwangerschaft noch einmal prüfen.
Was die Osteoporose angeht, gab es in der Leitlinie von 2023 einige Neuerungen. Eine Basisdiagnostik sollte man nun bei einer Risikokonstellation für Frakturen bei postmenopausalen Frauen und Männern ab 50 Jahren sowie generell ab dem 70. Lebensjahr anbieten. Für die Entscheidung zur Therapie zählt jetzt das Dreijahresrisiko statt wie zuvor das Zehnjahresrisiko. Angeraten wird eine Behandlung, wenn die Gefahr für Wirbelkörper- oder Schenkelhalsfrakturen innerhalb von drei Jahren mehr als 5 % beträgt. Außerdem besteht eine generelle Empfehlung dafür, nach niedrigtraumatischen einzelnen Wirbelfrakturen 2. oder 3. Grades oder multiplen Wirbelfrakturen 1.–3. Grades sowie nach Bruch des Schenkelhalses. Eine osteoanabole Therapie befürworten die Leitlinienautoren ab einem Risiko > 10 % pro drei Jahre für Wirbel und Schenkelhals.
Zum Schluss sprach Prof. Reincke noch über den primären Hyperaldosteronismus. Sein wichtigstes Kennzeichen: eine Hypertonie bei normal bis hohen Aldosteronwerten in Relation zum supprimierten Renin. Außerdem finden sich eine Natriumretention und eine Kaliumdiurese.
„Der primäre Hyperaldosteronismus ist die häufigste sekundäre Hypertonieform, die aber leider meist ignoriert wird“, bemängelte der Kollege. Die meisten betrachten die Erkrankung als selten, entsprechend wird kaum danach gesucht. Eine Studie aus dem Jahr 2022 mit Daten von 2009 bis 2015 zeigte, dass unter Patienten mit Hypertonie und Hypokaliäme die Rate der jemals Gescreenten gerade einmal bei 1,6 % lag. Prof. Reincke appellierte daher dringend ans Auditorium, mittels Messung des Aldosteron-Renin-Verhältnisses häufiger darauf zu testen.
Quelle: Kongressbericht