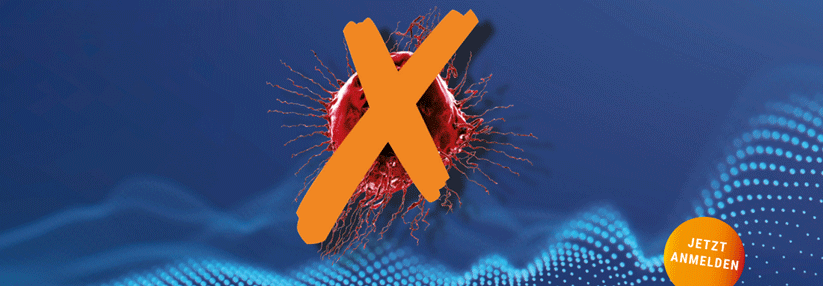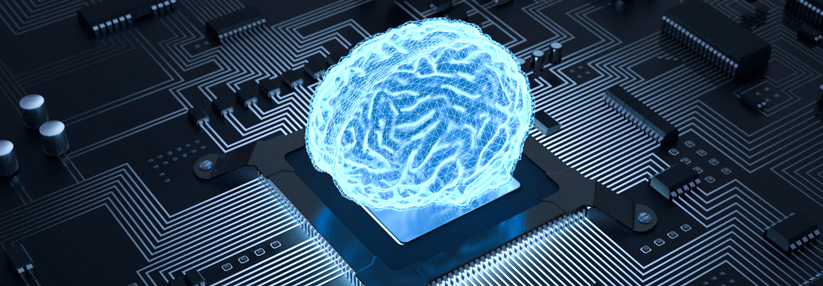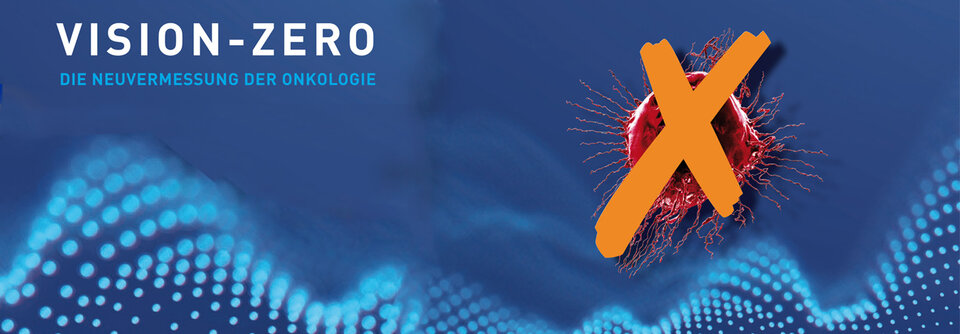
Physician Scientists: Schnittstellen zwischen Labor und Klinik nicht adäquat besetzt
 Im Interview: Professor Dr. Stefan Fröhling. Er ist Geschätsführender Direktor (komm.) am NCT Heidelberg und Abteilungsleiter „Translationale Medizinische Onkologie“ des DKFZ.
© Gorodenkoff – stock.adobe.com; NCT Heidelberg
Im Interview: Professor Dr. Stefan Fröhling. Er ist Geschätsführender Direktor (komm.) am NCT Heidelberg und Abteilungsleiter „Translationale Medizinische Onkologie“ des DKFZ.
© Gorodenkoff – stock.adobe.com; NCT Heidelberg
Wo fängt die Translation eigentlich an und wo hört sie auf?
Professor Dr. Stefan Fröhling: Sie fängt in den Forschungslabors an, wenn Mitarbeiter versuchen, Krankheitsmechanismen zu verstehen, und eine Idee entwickeln, wie man daraus etwas medizinisch Sinnvolles ableiten könnte. Unser Ziel ist es dann, solche Ideen konzeptionell auszubauen und mindestens in die klinische Prüfung zu bringen.
Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo dies gelungen ist?
Prof. Fröhling: Ein Beispiel dafür ist das MASTER-Programm des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung. Darin erhalten Patienten mit fortgeschrittener Tumorerkrankung eine genomweite DNA- und RNA-Sequenzierung. Deren Ergebnisse werden dann unter klinischen Gesichtspunkten ausgewertet. Dabei fiel auf, dass 20 % der Patienten mit unterschiedlichsten Krebserkrankungen Hinweise auf eine bestimmte Störung der DNA-Reparatur aufwiesen, die wir bislang nur von Frauen mit Brust- und Ovarialkrebs und Männern mit Prostatakrebs kannten. Wir konnten dann für diese Patienten sehr rasch eine Studie aufsetzen, in der eine Chemotherapie mit einer PARP-Inhibition kombiniert wird.
Das ist typisch für die translationale Onkologie: Wir machen Grundlagenforschung, es folgen Beobachtungen am Patienten, die tragen wir zurück ins Labor, um sie besser zu verstehen, und schließlich gehen wir mit einem Konzept in die klinische Prüfung. Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Translation liefert das Netzwerk für Genomische Medizin Lungenkrebs. Dort haben die Kollegen bei Lungenkrebspatienten sehr fokussiert nach genetischen Veränderungen mit therapeutischer Relevanz gesucht und darauf aufbauend ein tolles Portfolio an Studien initiiert.
Dennoch gibt es die Klage, dass Innovationen bei uns oft nur schwer zum Patienten finden. Warum?
Prof. Fröhling: Das größte Defizit besteht meiner Meinung nach darin, dass wir die Schnittstellen zwischen Labor und Klinik personell nicht adäquat besetzen können. Wir brauchen Mitarbeiter, die Medizin studiert und im Labor gearbeitet haben und beides verknüpfen können und wollen. Und wir müssen die Stellen für solche Mitarbeiter schaffen. Es ist dieses Konzept des „Physician Scientists“, das bei uns – anders als etwa in den USA – noch nicht so Fuß gefasst hat. Das DKFZ oder auch die Helmholtz-Gemeinschaft sind aber auf einem guten Weg, dieses Konzept zu entwickeln und Positionen sowie Karrierewege zu schaffen.
Ein weiteres Problem in Deutschland: Wenn wir Studien initiieren wollen, stoßen wir oft auf hohe organisatorische und regulatorische Hürden. Der Aufwand, Geld für Investigator-initiated Trials einzuwerben oder ein innovatives Studiendesign genehmigt zu bekommen, ist enorm.
Wo haben uns andere Länder noch etwas voraus?
Prof. Fröhling: In den USA sind es der Fortschrittsglaube, der Pioniergeist und die „Can-Do“-Attitüde. Auch wenn wir diese Haltungen manchmal belächeln, so glaube ich doch, dass sie ein starker Motor sind, während uns die hiesige Skepsis manchmal ausbremst. In Frankreich ist die stark zentralisierte Struktur hilfreich. Dadurch schaffen es unsere onkologischen Kollegen immer wieder sehr rasch, für Studien das ganze Land hinter sich zu bringen und dank großer Kollektive auch verzwickte Fragestellungen anzugehen. Das funktioniert bei uns aufgrund der ausgeprägten föderalen Struktur nicht so gut. Wir sind in diesen Dingen bisweilen ein bisschen langsamer – dafür dann aber auch sehr gründlich.
5. Internationales Symposium„Innovations in Oncology“
- Voraussetzungen für die Vision-Zero
- Prävention und Früherkennung
- ASCO-Hotline mit Highlights vom amerikanischen Krebskongress und vom EHA
- Innovative Therapiekonzepte
- Smart Data in der Onkologie
Vorbericht – Symposium „Innovations in Oncology“