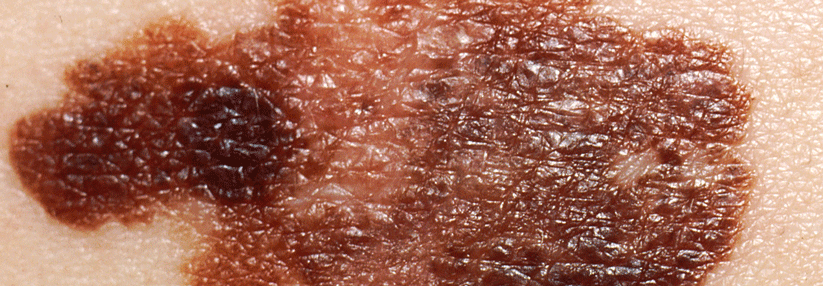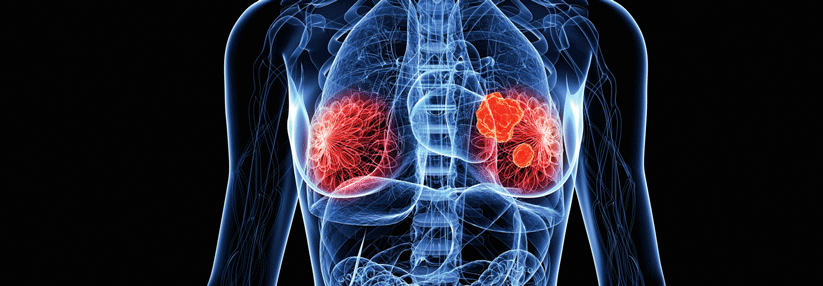Ein Interview „Spürbar, welche Anstrengungen hinter den Betroffenen und ihren Familien liegen“
Was beinhaltet die psychoonkologische Nachsorge von Kindern mit überstandener Krebserkrankung?
Dr. Susanne Wendt: Die posttherapeutische Begleitung der Patient:innen und Familien gelingt am besten im Einklang mit der psychoonkologischen Nachsorge, weil es hier oft um Fragen der emotionalen Belastung, Compliance oder Themen der Wiedereingliederung geht. Im weiteren Verlauf treten oftmals Schwierigkeiten im Bereich der Krankheitsverarbeitung auf.
Viele Betroffene und ihre Familien spüren die Belastungen der Behandlung im Nachgang nochmal anders als zur Zeit der Akuttherapie. Idealerweise orientiert sich eine Nachsorge am Bedarf der Patient:innen, ist zeitgleich interdisziplinär ausgerichtet und bezieht die psychosoziale Perspektive direkt mit ein.
Dr. Florian Schepper: In der Nachsorge wird spürbar, welche Anstrengungen hinter den Betroffenen und ihren Familien liegen. Während auf der Akutstation der Behandlungsfokus auf dem Überleben liegt, ist das Ziel der Nachsorge, das „normale“ Leben wiederaufzunehmen und fortzuführen.
Psychosoziale Mitarbeiter:innen im Akutsetting arbeiten „peritraumatisch“, d. h. sie sind während der Verletzung dabei und versuchen, die Belastungen der Erkrankung und Behandlung bewältigbarer zu gestalten. Hier sind Gespräche genauso wichtig wie unterstützende Verfahren, z. B. Kunst-, Musik- und Sporttherapie. Im besten Fall haben wir so gut begleitet, dass die Patient:innen die stationäre Zeit sogar als „schön“ erlebt haben, was seltsam klingen mag. Aber wenn Kinder gerne zu uns kommen, obwohl dort große Anstrengungen auf sie warten, haben wir viel erreicht.
In der Nachsorge arbeiten wir dann posttraumatisch, klassisch wie es in Beratungsstellen oder im Bereich der Psychotherapie üblich ist. Dann geht es mehr um das Einordnen, Verarbeiten und Bewältigen des Erlebten, gekoppelt mit der Frage, wie es weitergeht.
Wie ist die Nachsorge an ihrem Klinikum organisiert?
Dr. Wendt: Wir bieten eine spezielle Sprechstunde an, die ihren Auftakt in einem interdisziplinären Überleitungsgespräch hat, d. h. zusammen mit dem psychosozialen Team der Station und der Familie. Die Eltern erhalten einen Plan und können sich orientieren, was in der nächsten Zeit ansteht. Während der stationären Therapie sind die Patient:innen stark vom medizinisch-psychosozialen System umsorgt, in der Nachsorge wird dies weniger.
Unsere Besonderheit in Leipzig ist die enge Verzahnung mit dem psychosozialen Team, sodass es eigentlich zu einer nahtlosen Weiterbetreuung durch die entsprechenden Fachkräfte kommt. Es gehört zum medizinischen Nachsorgekonzept, dass wir nicht nur körperliche und apparative Untersuchungen durchführen, sondern auch immer die psychosoziale Entwicklung im Blick behalten und auch hier spezifische Instrumente einsetzen.
Dr. Schepper: Das psychosoziale Nachsorgeangebot am Standort Leipzig ist vielfältig. Es wird von der Beratungsstelle „Ambulante Psychosoziale Nachsorge“ in Trägerschaft der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig organisiert und beinhaltet neben der Selbsthilfe auch umfangreiche professionelle Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung der Patient:innen sowie der gesamten Familie.
Es werden auch weitere Personengruppen und Systeme in die Nachsorge integriert: So gibt es Angebote für Geschwister, junge Erwachsene, ehemalige Patient:innen, Mütter und Väter sowie für die gesamte Familie. Und auch im Trauerfall wird eine umfassende Begleitung angeboten. Der fachliche Standard und die komplexe Vielfalt in Leipzig sind sowohl im Bereich der stationären psychosozialen Versorgung als auch im Bereich der ambulanten psychosozialen Nachsorge außerordentlich hoch.
Wie wird die Nachsorge finanziert?
Dr. Wendt: Die medizinische Nachsorge ist eine Versicherungsleistung und steht allen Patient:innen in Deutschland zur Verfügung. Anders ist dies im Bereich der psychosozialen Nachsorge.
Dr. Schepper: Die psychosoziale Versorgung krebskranker Kinder in Deutschland ist leider nicht einheitlich geregelt und finanziert sich überwiegend durch Spenden oder eingeworbene Drittmittel. Ohne Elternvereine wie die Elternhilfe für krebskranke Kinder wäre die Versorgung im stationären Kontext vollkommen unzureichend.
Dass eine spendenfinanzierte Arbeit in dieser Form existiert, ist einerseits bewundernswert, andererseits traurig. Die Abhängigkeit der psychosozialen Versorgung von Spenden ist dramatisch. Im Bereich der ambulanten psychosozialen Nachsorge etablieren sich mittlerweile deutschlandweit Angebote, welche in bestimmtem Umfang im Falle der Anerkennung als Krebsberatungsstellen refinanziert werden können.
Im Jahr 2023 gewannen Sie den Anerkennungspreis der Deutschen Kinderkrebsnachsorge für das diagnostische Tool „NPO-11“ – um was handelt es sich hierbei?
Dr. Wendt: Es handelt sich um einen Fragebogen, der uns als Mediziner:innen erlaubt, schnell, einfach und valide die Belastungen der Familien einzuschätzen. Die erfassten Themen können wir dann zielgerichtet an den psychosozialen Dienst richten.
Natürlich ist dieses Tool nur ein Teilaspekt der Anamnese hinsichtlich möglicher Bedarfe. Aber es unterstützt eben zeitökonomisch unser klinisches Urteil. Der NPO-11 hilft uns dabei, dieses abzusichern und objektiver im Zeitverlauf zu erfassen.
Dr. Schepper: Wir haben den Fragebogen interdisziplinär entwickelt, gemeinsam mit psychosozialen Kolleg:innen von anderen Standorten, aber auch mit ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitenden. Das stellt einen wichtigen Faktor für dessen Nutzbarkeit dar. Und das besondere ist nicht nur, dass der Fragebogen umfangreich evaluiert wurde, sondern in vollem Umfang frei verfügbar und somit in allen Zentren im deutschsprachigen Raum einsetzbar ist.
Welche Rolle spielt das Thema „Progredienzangst“ in der Nachsorge?
Dr. Wendt: Das ist abhängig von den einzelnen Familien und deren Verarbeitungsstrategien. Manche blenden das mögliche Wiederauftreten der Erkrankung aus, andere teilen diese Sorgen nicht mit uns. Aber generell lässt sich sagen, dass Progredienzängste eine große Belastung in der Nachsorge sind. Und zwar sowohl für Patient:innen als auch für deren Eltern.
Zudem gilt: Zeit allein heilt nicht alle Wunden – Progredienzängste bleiben über Jahre stabil und lassen sich nicht ausschließlich über medizinische Fachinformationen reduzieren. Hohe Sorgen können zu weiteren Einschränkungen führen, zum Beispiel, dass Elternteile die Klinik nicht mehr betreten können oder eine wiederkehrende Überdiagnostik einfordern.
Dies ist bei der Vorgeschichte verständlich und für uns Ärzt:innen dann schwer zu steuern – wir versuchen stets im Konsens mit den Eltern und Patient:innen einen Weg zu finden, sodass diese sich wieder sicher fühlen können. Gleichzeitig wollen wir aber mit nicht notwendigen medizinischen Untersuchungen die Kinder auch nicht belasten oder gar gefährden.
Buchtipp: Progredienzangst therapeutisch lindern
Das Buch „Therapie-Tools: Progredienzangst in Familien mit chronisch kranken Kindern“ hilft Betroffenen dabei, mit der Angst vor Rezidiven umzugehen. Mithilfe des Protagonisten, dem Hasen Filipo, und kindgerechten Comics gelingt es, mit Kindern über ihre Ängste zu sprechen. Die Materialien des Tool-Buchs liefern Hintergrundwissen zur spezifischen Progredienzangst bei chronischen/fortschreitenden Erkrankungen. Das Buch bietet umfangreiche Materialien sowohl für die Arbeit mit den erkrankten Kindern als auch für Gespräche mit den Eltern.
In weiteren Forschungsprojekten beschäftigen Sie sich gezielt mit der Progredienzangst von Betroffenen – was können Sie uns hierüber berichten?
Dr. Schepper: Wir haben unsere Forschungsbemühungen der vergangenen Jahre zusammengefasst und uns ein Vorgehen überlegt, wie sich diese Ängste bewältigen lassen. Im Bereich der Erwachsenenonkologie gibt es bereits vielversprechende Ansätze, für Kinder und deren Eltern jedoch nicht. So entstand unser Angebot „Geteilte Angst, gemeinsam mutig“ und beinhaltet neben kindgerechten Aufklärungsmaterialien auch gezielte Übungen zur Bewältigung von belastenden Ängsten. Die wissenschaftliche Begleitstudie, welche von der Deutschen Kinderkrebsstiftung gefördert wurde, konnte zudem die Wirksamkeit und nachhaltige Reduktion der Ängste belegen.
Dr. Wendt: Und das merken wir auch in der Nachsorge. Wenn Eltern oder Patient:innen an dem Programm teilgenommen haben, haben sie deutlich weniger Ängste.
Geschwister von krebskranken Kindern werden oftmals vernachlässigt. Was bietet die Nachsorge speziell für sie an?
Dr. Wendt: Geschwister sehen wir nicht oder nur sehr selten in der medizinischen Nachsorge. Wenn sie mit dabei sind, versuchen wir, sie einzubinden. Oftmals ist es aber eher so, dass die Eltern uns über deren Probleme berichten. Dann verweisen wir sie weiter an unseren psychosozialen Dienst.
Dr. Schepper: Die Angebote für Geschwister sind mittlerweile sehr umfangreich. Es gibt sie für fast jede Altersgruppe, teilweise als refinanzierte Präventionsangebote. In diesem Bereich hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel ergeben. Über die Stiftung Familienbande kann man sich einen Überblick verschaffen, wo in der Nähe ein spezifisches Angebot für Geschwisterkinder existiert.
Für den Bereich der stationären Versorgung ist die Perspektive der Geschwister jedoch noch unzureichend berücksichtigt: Es gibt kaum Angebote, die die Familie als Ganzes während der Zeit der Akutversorgung adressieren. Damit meine ich vor allem: Angebote direkt auf Station, die dazu führen könnten, dass auch das Geschwisterkind erfährt, wie es dort für dessen Schwester oder Bruder ist, und welche zu gemeinsamen Erinnerungen und Wissen über die Zeit der Behandlung führen.
Während der Coronapandemie ist der Einbezug von Geschwisterkindern komplett eingebrochen und meines Erachtens nach hat sich dies noch nicht erholt. Zudem geschieht der Einbezug der Familie oder der Geschwister während der Akuttherapie meist ohne konzeptionelle Verankerung. Eigentlich benötigt es hier ein Konzept, wie Geschwister bzw. die Familie als Ganzes adressiert und wirksam einbezogen werden können.
Wo sehen Sie in Deutschland Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Nachsorge von Kindern mit überstandener Krebserkrankung?
Dr. Wendt: Zum einen ganz klar bei der Transition von jungen Erwachsenen, die eine Krebserkrankung überlebt haben. Das gilt vor allem für Patient:innen, die vielfältige Einschränkungen haben. Es ist hier sehr schwer, die Betroffenen in interdisziplinäre Netzwerke zu überweisen.
Zum anderen in der nicht gesicherten Finanzierung der psychosozialen Versorgung bereits während der Akuttherapie. Wir haben großes Glück mit der Elternhilfe am Standort Leipzig. Aber es fehlen nachhaltige Finanzierungskonzepte, die unabhängig sind von Spendeneinnahmen und etwaigen Krisen und damit verbundenen finanziellen Einbrüchen.
Dr. Schepper: Was die Angebote betrifft, ist viel geschafft. Ich denke, es fehlt an der einen oder anderen Stelle noch thematisch an Differenzierungen. Bei Patient:innen mit neurokognitiven Einschränkungen, zum Beispiel nach Hirntumoren, fehlen Angebote zur gezielten Förderung – das gibt es nur an wenigen Standorten.
Die psychosoziale Versorgung stellt einen integrativen Bestandteil der medizinischen Therapie dar. Die ausgegliederte Finanzierung widerspricht diesem Umstand jedoch. Je nachdem, an welcher Klinik eine Person behandelt wird, gibt es dann eben mehr oder weniger psychosoziale Angebote, während die medizinische Behandlung überwiegend standardisiert und vergleichbar ist.
Haben Sie konkrete Empfehlungen für Onkolog:innen in Bezug auf die medizinische und psychosoziale Nachsorge?
Dr. Wendt: Die Kolleg:innen können sich immer gerne bei uns melden. Zudem ist es wichtig, interdisziplinär zu denken und zu handeln. Die möglicherweise auftretenden Spätfolgen können sich außerhalb der ursprünglichen Tumormanifestation zeigen. Es geht im späteren Verlauf eben viel mehr darum, die Patient:innen gesund zu halten und mit den vorhandenen Einschränkungen weiter ins Leben zu begleiten.
Dr. Schepper: Neben dem Einbezug der vorhergehenden Behandler:innen lohnt es sich immer zu prüfen, ob in der Nähe eine offiziell anerkannte Krebsberatungsstelle vorhanden ist. Oder aber ein selbsthilfeorientierter Verein. Eine Vernetzung an dieser Stelle ist oftmals dankbar und zum Wohle der Patient:innen und deren Familien.
Interview: Dr. Miriam Sonnet