
Nachhaltige Narkose Wie die Wahl des Anästhetikums beim Klimaschutz helfen kann
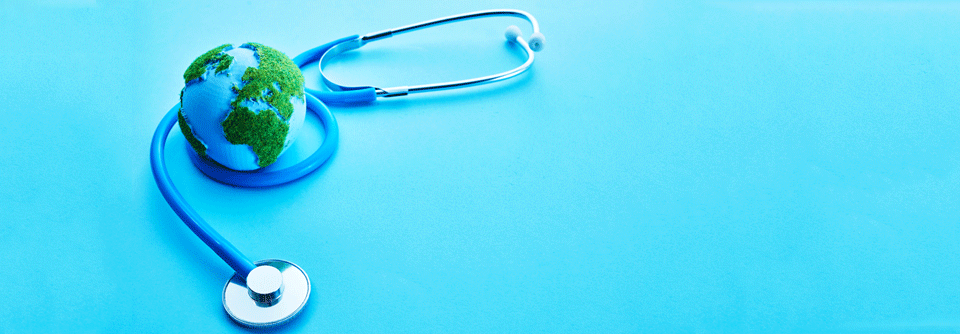 Die Charité setzt seit Ende 2023 auf Propofol statt Desfluran, um das Klima zu schonen.
© vetre – stock.adobe.com
Die Charité setzt seit Ende 2023 auf Propofol statt Desfluran, um das Klima zu schonen.
© vetre – stock.adobe.com
Welche Anästhetika kommen in Deutschland für Vollnarkosen zum Einsatz und welche Auswirkungen haben Narkosegase auf das Klima?
PD Dr. Susanne Koch: In Deutschland gibt es drei Produkte für Vollnarkosen, die in den 1990er Jahren auf den Markt kamen: Die beiden Anästhesiegase Sevofluran und Desfluran sowie das intravenös applizierte Propofol. Anästhesiegase sind FKW- bzw. FCKW-Verbindungen und haben ein sehr hohes Treibhauspotenzial. Dieses ist bei Sevofluran deutlich geringer als bei Desfluran – im Vergleich zu Propofol ist das Treibhauspotential von Sevofluran aber immer noch wesentlich höher.
Kanadische Anästhesist:innen haben hier ein anschauliches Bild entworfen: Mit einer siebenstündigen Desfluran-Narkose wird der gleiche CO2-Fußabdruck erzeugt wie bei einer Autofahrt von Berlin bis nach Nairobi. Mit einer siebenstündigen Sevofluran-Narkose käme man mit dem Auto „nur“ bis nach Monaco.
Was war der Anlass dafür, dass Sie an der Charité vom Narkosegas Desfluran auf das intravenöse Propofol umgestellt haben?
Dr. Koch: Im Jahr 2018 begann ich damit, mich mit der Nachhaltigkeit in der Klinik, insbesondere in der Anästhesie, zu beschäftigen. Und hier stechen eben die Anästhesiegase aufgrund ihres schädlichen Umwelteinflusses enorm hervor. Im Kyoto-Protokoll sind Gesundheitsprodukte allerdings nicht berücksichtigt – es geht also zunächst darum, die diesbezüglichen Expertisen der klinisch tätigen Ärzt:innen mit klimawissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenzubringen.
Wir haben uns daher gefragt, ob es wirklich notwendig ist, Desfluran trotz seines hohen Treibhauseffekts zu verwenden, oder ob wir nicht auf eine umweltfreundlichere Alternative umstellen können.
Größter Effekt durch Entscheidungen der Klinikleitung
Im Rahmen einer Beobachtungsstudie prüften die Forschenden der Charité, welche Maßnahmen den größten Einfluss auf den CO2-Ausstoß hatten. Das Ergebnis: Am schnellsten und nachhaltigsten war eine Anpassung der zentralen Standardvorschriften, an die sich die Anästhesist:innen halten müssen.
Quelle:
Schwiethal A et al. Anesth Analg; DOI: 10.1213/ANE.0000000000007375
Gibt es neben den umweltbezogenen Nachteilen von Desfluran auch solche, die die Patient:innen direkt betreffen?
Dr. Koch: Es ist bekannt, dass Desfluran kaum verstoffwechselt wird, was dazu führt, dass Patient:innen schnell einschlafen und auch wieder aufwachen. In einer Studie haben wir zeigen können, dass das schnelle Aufwachen nach der Narkose einen Verwirrtheitszustand herbeiruft. Gerade bei älteren Personen ist das der Fall. Diese Verwirrtheit kann länger anhalten und mit kognitiven Einschränkungen einhergehen. Auch aus Patient:innensicht ist Desfluran daher nicht unbedingt die beste Wahl.
Wie wirkte sich die Umstellung auf die CO2-Emissionen aus?
Dr. Koch: Die Charité konnte die CO2-Emissionen, die durch den Anästhetikagebrauch entstehen, um mehr als 80 % senken . Vor 2018 betrugen diese rund 1.470 Tonnen im Jahr, im Jahr 2023 waren es nur noch 142 Tonnen pro Jahr. Auf die gesamte Charité betrachtet macht das allerdings nur 1 % der CO2-Emissionen pro Jahr aus. Die Welt haben wir damit also noch nicht gerettet, aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.
Was waren weitere Vorteile?
Dr. Koch: Wir konnten durch die Umstellung die Ausgaben für Anästhetika von rund 540.000 Euro jährlich auf ca. 280.000 Euro halbieren. Umso erstaunlicher finde ich es, dass manche Kliniken an Desfluran festhalten, wo Propofol doch so viel günstiger ist.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Desfluran und Propofol hinsichtlich der Narkose?
Dr. Koch: Während einer Operation werden die Medikamente kontinuierlich gegeben, bis der Eingriff zu Ende ist. Propofol wird intravenös appliziert und lagert sich zum Teil auch im Fettgewebe ab. Die Anästhesist:innen brauchen ein besseres Verständnis dafür, wie lange die Substanz im Körper wirkt und wie lange vor Ende der Operation sie die Medikamentengabe beenden müssen.
Demgegenüber werden Anästhesiegase im Körper kaum verstoffwechselt, das heißt: Die Patient:innen atmen die Gase ein, schlafen ein, atmen aus und werden wach. Das Ganze ist daher sehr einfach zu steuern, was wiederum den Vorteil brachte, dass die Auslastungszeiten von Operationssälen erhöht werden konnten – auch mit relativ jungen und unerfahrenen Anästhesist:innen. Das war bei Markteinführung von Desfluran das wichtigste Verkaufsargument.
Erfordert die Nutzung von Propofol gegenüber Desfluran besondere Vorsichtsmaßnahmen bzw. ändert sich die Überwachung?
Dr. Koch: Die Narkosetiefe wird in Deutschland mittlerweile mittels Ableitung der Hirnaktivität über der Stirn, dem sog. Neuromonitoring, überwacht. Damit lässt sich auch eine Propofolnarkose sehr gut steuern. Anästhesist:innen können mittels Neuromonitoring sehr gut abschätzen, wann sie die Narkosemittelgabe beenden können, ohne dass die Patient:innen zu früh wach werden oder deutlich länger schlafen. Es lässt sich anhand der Hirnaktivität genau prüfen, wo man mit der Sedierungstiefe gerade steht. Das Argument für den Einsatz von Desfluran der sehr guten Narkosesteuerung – gegenüber Propofol – existiert damit nicht mehr.
In welchen Fällen setzen Sie weiterhin auf gasförmige Narkosemittel?
Dr. Koch: Die Charité hat Desfluran komplett gestrichen, in einigen Fällen verwenden wir aber noch das klimafreundlichere Sevofluran. Dieses ist besser verträglich, insbesondere reizt es weniger die Atemwege. Daher kommt es vor allem bei Kindern zum Einsatz, denen man keinen intravenösen Zugang legen möchte, bevor sie eingeschlafen sind.
Ich würde auch nicht empfehlen, komplett auf nur ein Anästhetikum umzustellen – unter anderem, weil es bei Propofol teilweise zu Lieferkettenengpässen kommt. In diesen Zeiten ist es immer wichtig, Ausweichmedikamente zu haben.
Will die Charité weitere Maßnahmen umsetzen, die dem Klimaschutz dienen sollen?
Dr. Koch: Wir werden definitiv weitere Maßnahmen für mehr Klimaschutz umsetzen. Ich bin in ein Projekt involviert, bei dem es erstmal darum geht, die konkreten Zahlen des CO2 - Fußabdrucks von Plastikprodukten zu erheben, die wir in den vergangenen zehn Jahren in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin verbraucht haben. Wir haben den Eindruck, dass die Nutzung von Einmal-Plastikprodukten im Rahmen der COVID-19 Pandemie deutlich angestiegen ist, aber nach Ende der Pandemie nicht wieder auf das Vorniveau sank.
Außerdem wollen wir der Frage nachgehen, was die Gründe für die weiterhin hohe Nutzung sind. Und welche Einmalplastikprodukte wir zukünftig vermeiden können, ohne Hygienevorgaben oder die Patient:innen- und Personalsicherheit zu gefährden.
Das Kyoto-Protokoll
Weltweit ist das Kyoto-Protokoll der erste völkerrechtlich verbindliche Vertrag zur Eindämmung des Klimawandels. Die beteiligten Staaten verpflichten sich darin, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu reduzieren. Im Jahr 1997 wurde es von der dritten Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen angenommen; das Protokoll ist 2005 in Kraft getreten.
Was können Kolleg:innen bzw. andere Kliniken aus den Erfolgen der Charité lernen?
Dr. Koch: Für mich ist es ein großer Erfolg zu sehen, dass all mein Engagement am Ende doch zu einer Änderung und zur Einsparung von ca. 1.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr geführt hat, obwohl es anfangs viel Gegenwind gab.
Ich möchte also allen sagen, die sich für mehr Nachhaltigkeit in ihrer Klinik einsetzen: Bleibt dran, auch wenn es anfangs etwas schwerfällt. Mit Beharrlichkeit kann man sein Ziel erreichen! Und am wichtigsten: Bildet Banden – frei nach Pippi Langstrumpf – beziehungsweise sucht euch Gleichgesinnte, ggf. auch aus anderen Krankenhäusern und Praxen in Deutschland. Dann fällt es leichter und macht auch mehr Spaß.
Interview: Dr. Miriam Sonnet




