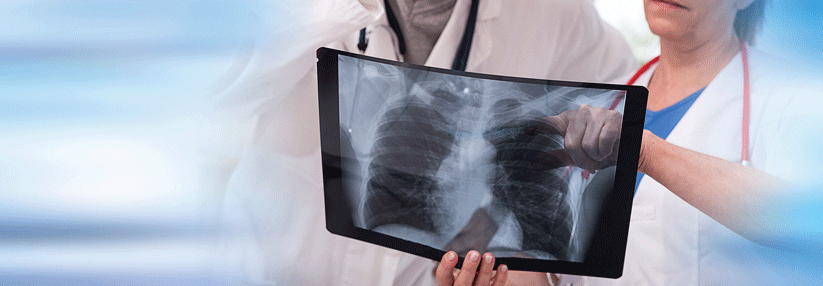
Mehr Druck auf Kliniken: AOK will Vergütung für Krebs-OPs kürzen
 © AOK-Mediendienst/MT
© AOK-Mediendienst/MT
Allein die Zahl der Todesfälle infolge von Lungenkrebs-Operationen könnte, so die Autoren des Qualitätsmonitors, um etwa ein Fünftel von 361 auf 287 Todesfälle pro Jahr sinken, wenn eine rein rechnerisch ermittelte Mindestmenge von jährlich 108 Eingriffen eingeführt würde. Herausgeber des Qualitätsmonitors sind das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO), der Verein Gesundheitsstadt Berlin und die Initiative Qualitätsmedizin. Die Analyse basiert auf Krankenhaus- Abrechnungsdaten von 2009 bis 2014 für insgesamt 25 Behandlungsarten.
Die Auswertungen zeigen auch für andere Eingriffe, dass Menschenleben durch Mindestmengenvorgaben gerettet werden könnten, wie Mitautor Professor Dr. Thomas Mansky, Leiter des Fachgebiets Strukturentwicklung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen der TU Berlin, deutlich macht. Eine Mindestmenge bei Darmkrebs-Operationen von 82 Eingriffen würde die Sterblichkeit pro Jahr um 8,6 % senken können. Das entspricht 380 „safed lifes“.
Bei Blasenkrebseingriffen wären es 32 Todesfälle weniger (-9,3 %, Mindestmenge: 31). 65 Personen weniger würden versterben bei Speiseröhren- Operationen (-25,4 %, Mindestmenge: 22). Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs wären es 124 Patienten (-24,5 %, Mindestmenge: 29). Insgesamt könnten bei all diesen Operationen fast 600 Menschenleben mehr die Krebsoperation überleben. Bisher hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) jedoch keine oder aus Sicht der AOK zu niedrige Mindestmengen festgelegt.
Kasse will dem Gemeinsamen Bundesausschuss Beine machen
Mindestmengen für komplizierte Operationen sind aus Sicht der AOK notwendig, weil noch immer zu viele Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, die nur sehr wenige Eingriffe durchführen und somit nicht über die entsprechende Erfahrung verfügen. Diese „Gelegenheitschirurgie ist nicht akzeptabel“, sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. Nach Angaben von Prof. Mansky wird ein Fünftel der Darmkrebs- Patienten in insgesamt 260 Kliniken operiert, die im Durchschnitt nur fünf dieser OPs pro Jahr durchführen. In 492 Kliniken, die im Durchschnitt 23 Fälle pro Jahr behandeln, lag das Risiko, infolge einer OP zu sterben, um 59 % höher als in den 71 Kliniken mit durchschnittlich 141 Operationen. Prof. Mansky empfiehlt deshalb, „Krankenhausabteilungen, die solche Fälle nur gelegentlich operieren, im Interesse der Patientensicherheit aus der Versorgung auszuschließen“. Schließlich handele es sich hier um planbare Eingriffe und nicht um Notfälle. Die AOK will nun ihre Forderung nach Einführung von Mindestmengen für komplizierte OPs bei Lungenkrebs und Brustkrebs in den G-BA einbringen und für Speiseröhren- und Bauchspeicheldrüsen-Krebs auf eine Erhöhung der Mindestmenge (bisher jeweils zehn) drängen.
Komplizierte Operationen in Zentren verlagern
„Wir haben hier die Verantwortung, etwas zu ändern“, betont der Verbandschef. Den Krankenhäusern wirft er vor, Bremser im Plenum zu sein. Die Vereinbarungen zu Ausnahmetatbeständen und Übergangsregelungen hätten erst kürzlich beschlossen werden können, obwohl der Auftrag dazu dem G-BA bereits im Januar 2016 erteilt worden sei. Litsch hält „mehr Druck“ für nötig, damit die Mindestmengen in den Krankenhäusern tatsächlich umgesetzt werden. Möglich sei dies durch die Einführung zentraler Strukturen, also Zentrenbildung, anstelle von Kliniken und Abteilungen, denen es an spezialisierten, erfahrenen Operateuren mangele und bei denen die Bedingungen für eine optimale Nachbehandlung fehlten. Das Geld für die Umstellung soll aus dem Strukturfonds kommen. Der müsste dann aber seitens des Gesetzgebers von derzeit einer Mrd. Euro auf 75 Mrd. Euro aufgestockt werden.
Vor allem aber will die AOK die Abschlagsregelung aus dem Krankenhausstrukturgesetz umsetzen: „Krankenhäuser, die die Vorgaben nicht einhalten und bei denen kein Ausnahmetatbestand vorliegt, erhalten von der AOK im Sinne der Patientensicherheit keine Vergütung mehr für diese Eingriffe“, stellt Litsch klar.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor vorschnellen und falschen Interpretationen der Studie. „Eine einfache Kausalität – vom operierenden Krankenhaus zum späteren Todesfall – aus der Interpretation von Abrechnungsdaten ableiten zu wollen und damit den Eindruck vermeidbarer Todesfälle in den Raum zu stellen, ist schlichtweg unseriös“, so Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Er stellt klar: Die Kliniken verweigerten sich möglichen Vorgaben zur Mindestmenge nicht und auch nicht der Zentrenbildung. Die Krankenkassen erschwerten das allerdings mit der Kündigung der Zentrumsvereinbarung und verweigerten somit neue Fördermöglichkeiten der Krankenhausreform.

