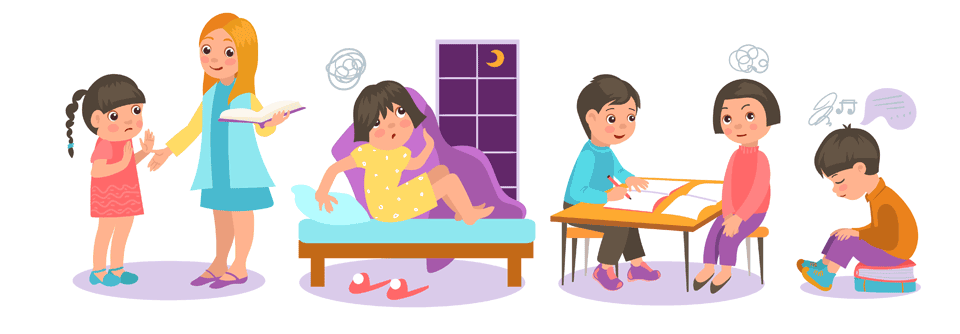
Cartoon Medizin und Markt
ADHS im Erwachsenenalter: Langzeitdaten der COMPAS-Studie bestätigen erneut gutes Sicherheitsprofil von MPH
 Die Auswertung der Studie wurde bei der Jahrestagung der DGPPN vorgestellt.
© oxie99 – stock.adobe.com
Die Auswertung der Studie wurde bei der Jahrestagung der DGPPN vorgestellt.
© oxie99 – stock.adobe.com
Sie hat außerdem – auch im längeren Therapieverlauf – ein sehr günstiges Sicherheitsprofil, das sich hinsichtlich neuropsychiatrischer, aber auch kardiovaskulärer unerwünschter Ereignisse nur wenig von einer Placebo-Therapie unterscheidet. Dies zeigt eine aktuell publizierte Detailauswertung des Sicherheitsendpunkts der randomisierten COMPAS-Studie. Sie wurde bei der virtuellen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) vorgestellt. Eine zweite Nachauswertung der COMPAS-Studie hat sich mit der differenziellen Effektivität von Gruppenpsychotherapie und klinischem Management beschäftigt.
Die Studie COMPAS (Comparison of Methylphenidate and Psychotherapy in Adult ADHD Study) war eine durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte, prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie im 2x2 Faktorialdesign.1 Verglichen wurden in insgesamt vier Studienarmen die Behandlung erwachsener ADHS-Patienten mit entweder MPH (Medikinet® adult) oder Placebo in Kombination mit entweder Gruppenpsychotherapie (GPT) oder klinischem Management bzw. Coaching (CM).
Die Primärpublikation der COMPAS-Studie zu den Effektivitätsendpunkten erfolgte im Jahr 2015. Sie hatte gezeigt, dass es in allen vier Behandlungsarmen zu einer signifikanten Verbesserung der ADHS-Symptomatik, erfasst mit dem ADHD Index Score, gekommen war. Dabei schnitten die Patienten in den beiden Studienarmen, in denen MPH eingenommen wurde, mit Abstand am besten ab. Hinsichtlich des primären Effektivitätsendpunkt gab es dagegen bei Kombination mit MPH keinerlei Unterschied zwischen GPT und CM, bei Kombination mit Placebo war GPT leicht im Vorteil.1 Im Gefolge der COMPAS-Studie und anderer Studien zur Arzneimitteltherapie bei adulter ADHS wurde die Behandlung mit Stimulanzien im Jahr 2018 als eine Standardtherapie in die deutsche S3-Leitlinie aufgenommen.2
MPH-Therapie bei Erwachsenen: Unerwünschte Ereignisse sind mild und gut beherrschbar
Ein wichtiges Merkmal der COMPAS-Studie sei gewesen, dass sie über den gesamten Studienzeitraum von 52 Wochen hinweg verblindet gewesen sei, sagte PD. Dr. Bernhard Kis vom St. Elisabeth-Krankenhaus in Niederwenigern. „Sie ist damit die am längsten laufende, randomisierte Studie zu MPH bei Erwachsenen“, so Kis. Das erlaube auch eine Bewertung der längerfristigen Sicherheit. Die detaillierte Sicherheitsanalyse der COMPAS-Studie wurde kürzlich publiziert und von Kis bei der DGPPN Tagung vorgestellt.3
Basis der Auswertung waren 209 Patienten in den Placebo-Gruppen und 205 Patienten in den MPH-Gruppen. In der Gesamtschau waren unerwünschte Ereignisse jeglichen Schweregrads in den MPH-Gruppen mit 96% gegenüber 88% in den Placebo-Gruppen signifikant häufiger. Das sei nicht überraschend gewesen, so Kis. Konkret verminderte MPH häufiger als Placebo den Appetit (22% vs. 3,8%) und führte häufiger zu Mundtrockenheit (15% vs. 4,8%), Herzklopfen (13% vs. 3,3%) und Agitiertheit (11% vs. 3,3%). Auch Schweißausbrüche und Gewichtsabnahme waren etwas häufiger, während Synkopen in den Placebo-Gruppen signifikant häufiger auftraten als in den MPH-Gruppen (0% vs. 2,4%).
Schwere unerwünschte Wirkungen und kardiovaskuläre Wirkungen auf Placebo-Niveau
„Die meisten dieser klinischen Ereignisse waren mild oder vorübergehend, oder sie konnten durch Dosisreduktion bzw. zeitweises Absetzen gut beherrscht werden“, so Kis. Schwere unerwünschte Ereignisse (severe adverse events, SAE) waren dagegen insgesamt sehr selten. Bei der Gesamtrate an SAE gab es keinen Unterschied zwischen MPH- und den Placebo-Gruppen. Als SAE gewertet wurden in den MPH-Gruppen je eine Episode von Anspannung/Depressivität, Suizidgedanken, Aggressivität und Schlafwandeln. In den Placebo-Gruppen traten dagegen vier Autounfälle sowie ein Sturz und eine Epicondylitis auf.
Ebenfalls keine relevanten Unterschiede gab es bei den kardiovaskulären unerwünschten Wirkungen. Konkret verhielt sich der systolische Blutdruck bei MPH- bzw. Placebotherapie ähnlich (+1,1 mmHg vs. +1,0 mmHg), diastolischer Druck und Herzfrequenz stiegen bei MPH-Therapie nur dezent stärker an (+1,3 mmHg vs. +0,1 mmHg bzw. +3,3 Schläge vs. –1,1 Schläge). Keine Gruppenunterschiede gab es auch bei den klinisch relevanten EKG-Veränderungen. In den MPH-Gruppen wurde eine Episode von QT-Zeit-Verlängerung beschrieben, in den Placebo-Gruppen gab es einmal Extrasystolie und einmal ST-Hebungen. Insgesamt bestätige sich damit Kis zufolge einmal mehr und auch im längeren Verlauf das gute Sicherheitsprofil von MPH. Dies sei auch deswegen bedeutsam, weil die COMPAS-Studie sehr nah am klinischen Alltag konzipiert gewesen sei und die Realität daher gut abbilde.
Gruppenpsychotherapie zeigt subjektive Vorteile gegenüber Coaching
Auf eine weitere Nachuntersuchung im Kontext der COMPAS-Studie ging Dr. Mona Abdel-Hamid von der Allgemeinen Psychiatrie am LVR-Klinikum Essen ein. Hier wurde analysiert, wie Patienten die Behandlung mit GPT bzw. mit CM subjektiv empfanden.4 Hinsichtlich der objektiven Ansprechrate, gemessen am ADHD Index Score, hatte es in der Hauptstudie keine Unterschiede gegeben.
Bei der subjektiven Bewertung stellte sich dies etwas differenzierter dar. So sei die GPT als Teil einer multimodalen Therapie mit MPH von 80% der Patienten als wirksam eingeschätzt worden, in Kombination mit Placebo von 64%. CM hingegen sei in Kombination mit MPH nur von 59% der Patienten als wirksam bewertet worden, und von nur 34% bei Kombination von CM und Placebo. „Das heißt, dass die Unterschiede in der Wahrnehmung von GPT und CM in den Placebo-Gruppen stärker ausgeprägt waren als in den MPH-Gruppen“, betonte Abdel-Hamid. Dies sei auch über die Zeit stabil geblieben.
Erklären lasse sich der Unterschied zwischen subjektiv empfundener und objektiv messbarer Wirksamkeit wahrscheinlich durch Wirkfaktoren der Psychotherapie, die über das hinausgehen, was ADHS-Scores messen. Insbesondere die therapeutische Beziehung und die damit einhergehende „korrigierende Beziehungserfahrung“ seien vertrauensfördernd und unterstützten die Fähigkeit zur selbständigen Problembewältigung, so Abdel-Hamid.
Referenzen:
1 Philipsen A et al. JAMA Psychiatry 2015; 72(12):1199-210
2 S3 Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“ (2018) AWMF-Registernummer 028-045 Rösler M et al. Psychotherapie 2008; 13:175-83
3 Kis B et al. Pharmacopsychiatry 2020; doi: 10.1055/a-1207-9851
4 Groß V et al. Jorunal of Attention Disorders 2017; doi: 10.1177/1087054717720718
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).
