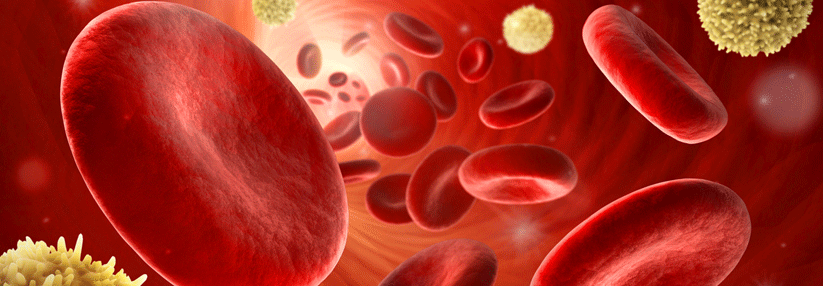
Antikoagulations-Dauer nach VTE festlegen
In den ersten Wochen nach Therapiebeginn sollte der Behandlungseffekt zunächst klinisch (Schwellung der Extremitäten etc.) überprüft werden.
Eine Ultraschallkontrolle hätte im ersten Monat noch keine Konsequenz, erklärte Professor Dr. Christiane Tiefenbacher von der Klinik für Innere Medizin I am Marienhospital Wesel und beruft sich dabei auf die aktuelle Leitlinie** zur Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und der Lungenembolie.
Drei Monate nach dem Ereignis macht eine Sonographie hingegen Sinn, v.a. um einen Residualthrombus auszuschließen. Zudem empfiehlt die Expertin dann eine Überprüfung des venösen Funktionsstatus mittels Verschluss-Plethysmographie (VVP).
Wann ein erhöhtes Blutungsrisiko vorliegt |
Für Patienten mit venöser Thromboembolie existiert kein valider Score zur Evaluation der Blutungsgefahr unter Langzeitantikoagulation. Folgende Faktoren gelten gemäß Leitlinie* als Prädiktoren eines gesteigerten Risikos:
Auch spielt das in klinischen Studien ermittelte Sicherheitsprofil der verschiedenen Antikoagulanzien eine Rolle.
*www.awmf.org Register Nr. 065/002 |
Geht es um die optimale Dauer der Antikoagulation, unterstützt eine aktuelle Untersuchung frühere Studien, die eine unbegrenzte Gerinnungshemmung bei Patienten mit niedrigem Blutungsrisiko (s. Kasten) befürworteten.
371 Teilnehmer – in diesem Fall nach idiopathischer Lungenembolie – erhielten sechs Monate lang Warfarin. Anschließend wurden sie in zwei Arme randomisiert: Über jeweils ca. 18 Monate bekam eine Hälfte weiter den Gerinnungshemmer (Ziel-INR 2,0–3,0), die andere ein Placebo.
Erste Reevaluation nach drei bis sechs Monaten
Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied zugunsten der verlängerten Antikoagulation: In dieser Gruppe lag die Rezidivrate bei 3,3 % (vs. 13,5 % unter Placebo).
Nach Absetzen der Therapie kam es im Warfarin-Arm zu einem sprunghaften Anstieg des Rezidivrisikos – über eine Nachbeobachtungszeit von zwei weiteren Jahren fast bis auf das Niveau der Placebogruppe. „18 Monate Antikoagulation reichen anscheinend immer noch nicht aus“, so Prof. Tiefenbacher.
Die Dauer der Behandlung müsse also regelmäßig und individuell überprüft werden. Für die erste Reevaluation gibt die Referentin einen Zeitraum von 3–6 Monaten nach Therapiebeginn an.
| Wichtige Aspekte bei Anamnese und klinischer Untersuchung | ||
| Kriterium | für verlängerte OAK | gegen verlängerte OAK |
| Risikofaktor | fortbestehend | passager |
| Genese | unklar | getriggert |
| Rezidiv | ja | nein |
| Blutungsrisiko | gering | hoch |
| Bisherige OAK-Qualität | gut | schlecht |
| D-Dimere (nach Therapieende) | erhöht | normal |
| Residualthrombus | vorhanden | fehlend |
| Geschlecht | Mann | Frau |
| Thrombus-Ausdehnung | langstreckig | kurzstreckig |
| Thrombus-Lokalisation | proximal | distal |
| Schwere Thrombophilie | ja* | nein** |
| Patientenpräferenz | dafür | dagegen |
*z.B. Antiphospholipid-Syndrom, **z.B. Faktor V- oder Prothrombinmutation, wenn heterozygot | ||
Verschiedene Kriterien helfen bei der Entscheidung, die Gerinnungshemmung fortzusetzen oder zu beenden (s. Tabelle). War z.B. die Einstellung auf Phenprocoumon schwierig und die Therapiequalität schlecht, würde die Expertin das Medikament eher absetzen.
„Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Patientenpräferenz“, betonte Prof. Tiefenbacher. Denn laut der aktuellen Datenlage kann man eine Antikoagulation weiterführen, muss es aber nicht tun. Der D-Dimerspiegel gilt nach einer neuen Studie jedoch eher als unzuverlässiges Entscheidungskriterium.
* Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
**www.awmf.org Register Nr. 065/002
Quelle: 11. DGK*-Kardiologie-Update-Seminar
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).
