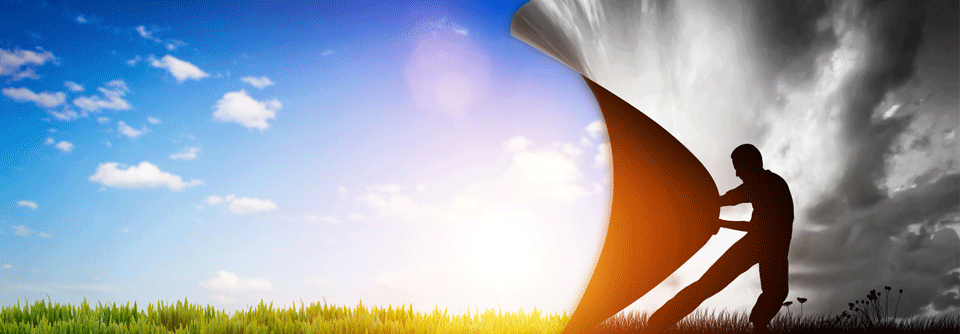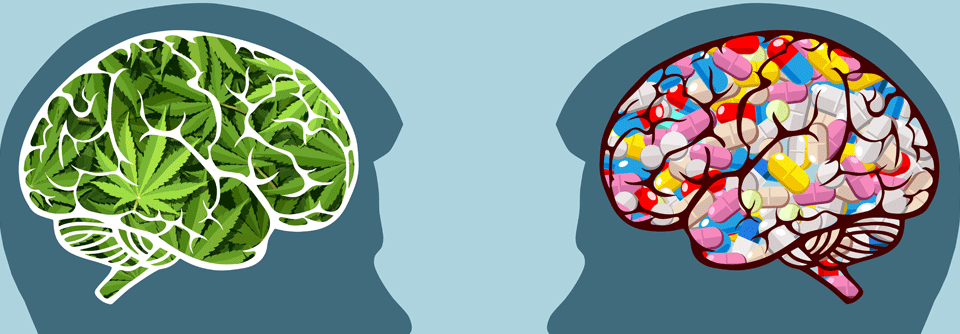
Medikamente verhindern depressive Episode nur beschränkt
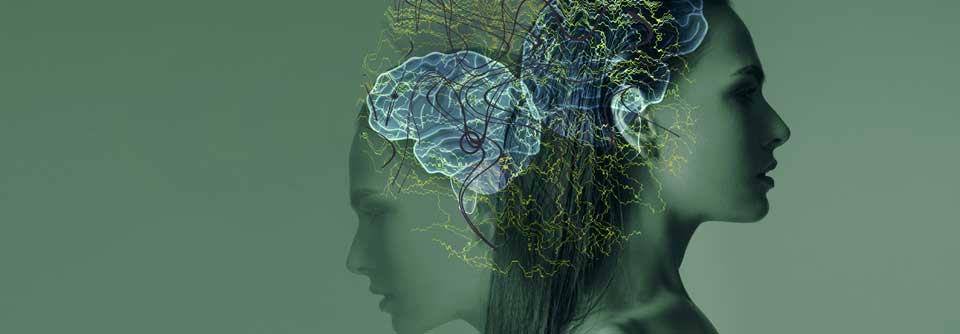 Gerade bei bipolaren Störungen sollte die gesamte Therapie individuell abgestimmt werden.
© Julia – stock.adobe.com
Gerade bei bipolaren Störungen sollte die gesamte Therapie individuell abgestimmt werden.
© Julia – stock.adobe.com
Auch bei leitliniengerechter Therapie sind Patienten mit einer bipolaren Störung nur etwa für die Hälfte der Zeit in euthymem Zustand. Depressive Episoden kommen dreimal häufiger vor als manische oder hypomane Phasen. Der depressive Anteil der Störung ist damit überwiegend für die psychosoziale Beeinträchtigung der Patienten verantwortlich, schreiben Dr. Kate Levenberg und Prof. Dr. Zachary Cordner, Johns Hopkins School of Medicine, in einer aktuellen Übersichtsarbeit.
Für die medikamentöse Behandlung einer depressiven Episode stehen einige moderne atypische Antipsychotika zur Verfügung: Olanzapin in Kombination mit Fluoxetin sowie Quetiapin, Lurasidon und Cariprazin, in den USA auch Lumateperon. Alle Substanzen haben signifikante Effekte gegen die akute depressive Symptomatik gezeigt. Der langfristige Einsatz von Neuroleptika scheitert jedoch oft, denn mehr als die Hälfte der Patienten mit bipolarer Depression nimmt zumindest teilweise die verordneten Medikamente nicht ein. Zu den Ursachen gehören mangelnde Krankheitseinsicht und intolerable Nebeneffekte.
Besonders Olanzapin hat eine Reihe bekannter Nebenwirkungen, darunter Gewichtszunahme sowie ein erhöhtes Risiko für das metabolische Syndrom und kardiovaskuläre Erkrankungen. Dazu kommen häufig Nausea und Diarrhö, vor allem in Kombination mit Fluoxetin. Wahrscheinlich deshalb weist Olanzapin im Vergleich zu den anderen Substanzen die geringste Adhärenzrate auf.
Nicht-medikamentöse Therapieoptionen
An nicht-medikamentösen Behandlungsansätzen gibt es die Elektrokrampftherapie (ECT), die vor allem in dringlichen Situationen wie drohendem Suizid, schwerer Psychose oder Katatonie rasch helfen kann. Bei behandlungsresistenter bipolarer Depression konnte die ECT im Vergleich zur medikamentösen Therapie eine doppelt so hohe Responserate erzielen. Auch diese Methode ist nicht nebenwirkungsfrei: Trotz zeitlich begrenzter Anwendung treten mitunter Gedächtnisprobleme auf.
Adjuvant leistet auch die kognitive Verhaltenstherapie gute Dienste. Sie genießt eine vergleichsweise hohe Akzeptanz bei den Betroffenen und hat ein geringes Risiko für Nebenwirkungen. Idealerweise greift sie mit der medikamentösen Behandlung ineinander, um die Adhärenz zur Pharmakotherapie zu erhöhen sowie depressive Symptome und Rückfallgefahr weiter zu reduzieren.
Sedierender Nebeneffekt steht bei Quetiapin im Fokus
Quetiapin vermindert die bipolare Symptomatik und zeigt auch positive Effekte auf Angst und Schlafqualität. Neben Gewichtszunahme treten unter dieser Substanz jedoch Mundtrockenheit, Obstipation und extrapyramidalmotorische Symptome (EPS) auf. Im Vordergrund steht der Nebeneffekt der Sedierung.
Lurasidon führt weniger zu Gewichtszunahme als Olanzapin/Fluoxetin und wirkt weniger sedierend als Quetiapin. Somnolenz gehört dennoch zu den häufigsten Nebeneffekten, neben Nausea und Akathisie. Ein kleiner, aber signifikanter Rückgang depressiver Symptome lässt sich auch mit Cariprazin erreichen, mit Insomnie, EPS, Akathisie, Nausea und Obstipation als Nebeneffekten. Die Gewichtszunahme ist dafür geringer ausgeprägt.
Lumateperon nimmt eine Sonderstellung ein, da es gleichzeitig Serotonin, Dopamin und Glutamin moduliert. Das Medikament hat bislang signifikant gute Response- und Remissionsraten gezeigt, bei relativ geringem Risiko für EPS, metabolische Veränderungen und Prolaktinerhöhung.
Für die Langzeitprophylaxe gibt es positive Daten für Olanzapin/Fluoxetin. Vor allem aber hat sich der klassische Stimmungsstabilisierer Lithium als wirksam erwiesen, einschließlich antisuizidaler Effekte. Gegen akute depressive Symptome wirkt er allerdings kaum. Bei rund der Hälfte der Patienten führt Lithium zu Nebeneffekten wie Polyurie, Gewichtszunahme, Tremor, Diarrhö, Gedächtnisstörungen und sexueller Dysfunktion. Langfristig entwickeln etwa 20 % der Patienten eine Hypothyreose.
Von den antiepileptischen Stimmungsstabilisatoren weist Lamotrigin die beste Datenlage bei bipolarer Störung auf. Vor allem Patienten mit schwerer Depression profitieren davon. Nebenwirkungen sind Sedierung, Insomnie, sexuelle Dysfunktion und Gewichtszunahme.
Ein besonderes Augenmerk legen die Autoren auf die Diskussion über Antidepressiva bei bipolar-depressiven Episoden. Auf die Gabe wird häufig verzichtet, weil die Substanzen eine Manie induzieren können. Dieses Risiko scheint jedoch geringer als meist angenommen: Eine Metaanalyse ergab eine Switch-Rate von 3,2 % für alle Antidepressiva, aber 4,7 % für Placebo. Nur trizyklische Antidepressiva zeigten mit 10 % ein deutliches Risikoprofil. Bei Patienten mit rapid cycling kann eine Langzeittherapie mit Antidepressiva das Cycling-Tempo steigern, vor allem wenn ältere Antidepressiva additiv zum Stimmungsstabilisierer eingesetzt werden.
Positiv schlägt für die Antidepressiva zu Buche, dass sie im Vergleich zu Antipsychotika besser verträglich sind. Es gibt durchaus Patienten mit bipolarer Störung, die langfristig von einer Erhaltungstherapie aus Stimmungsstabilisatoren und Antidepressiva profitieren, betonen die Autoren. Wie bei der gesamten Therapie gelte es hier, jeden Fall einzeln zu betrachten.
Noch keine Empfehlungen für neuere Ansätze möglich
Weitere vielversprechende Behandlungsoptionen sind noch in der klinischen Evaluation. Dazu gehören die transkranielle Magnetstimulation, Ketamin, Pramipexol, die Vagusnervstimulation und die additive Gabe von Schilddrüsenhormonen, welche das Therapieansprechen verbessern könnte. Für Empfehlungen ist es aber noch zu früh.
Quelle: Levenberg K, Cordner ZA. Gen Psychiatr 2022; 35: e100760; DOI: 10.1136/gpsych-2022-100760
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).