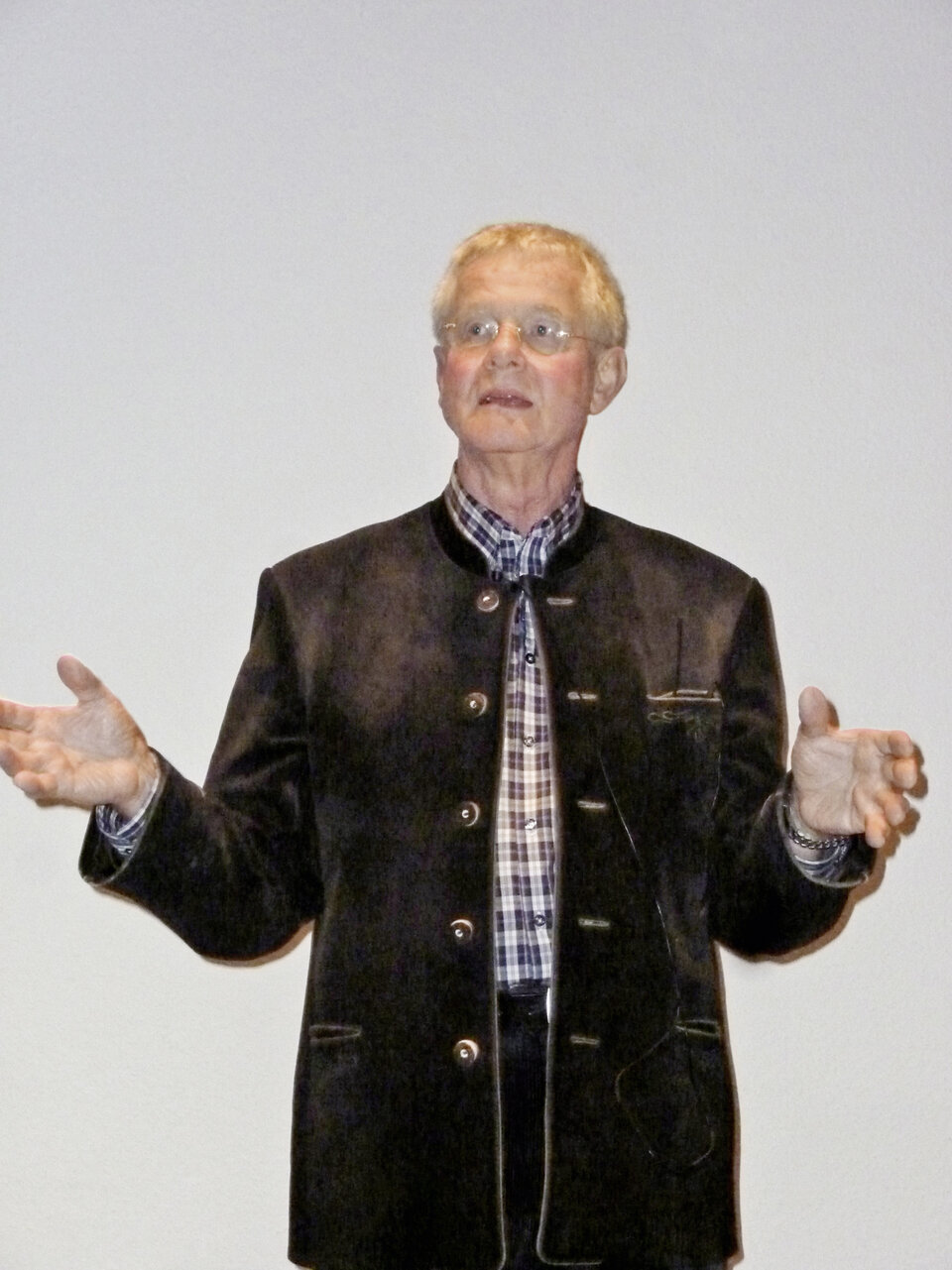Von Läusen und Flöhen

Ein Kollege schilderte den folgenden Fall: „Eine 27-jährige Patientin war in den 90er Jahren bei mir in Behandlung wegen einer depressiven Symptomatik. Eine Therapie mit Antidepressiva über ein Vierteljahr brachte keinen Erfolg. Schließlich entwickelte die junge Frau bulimische Symptome mit Erbrechen und starker gewichtsabnahme. die vermutete Essstörung ließ sich bestätigen und ich nahm Kontakt zu einer Klinik auf. vier Wochen nach der stationären Aufnahme erfuhr ich, dass die Patientin inzwischen im Koma lag. Sie war an einem Plexuspapillom operiert worden, was zu einem Hydrozephalus internus geführt hatte. Die Patientin blieb schwer beeinträchtigt. Der Klinikkollege machte mir den vorwurd, nicht von vornherein an eine Hirndrucksymptomatik gedacht zu haben. Bei Erbrechen müsse man das immer in Betracht ziehen“
„Hat noch jemand von Ihnen eine Gefährdung einer Anorektikerin durch eine falsche Fährte erlebt?“, fragte Moderator Prof. dr. med. Frank H. Mader das Auditorium. Niemand meldete sich. Allerdings ist die Anorexie per se in der Hausarztpraxis nicht gerade häufig vertreten. Ein Kollege aus einer Landarztpraxis berichtete, schon seit sechs Jahren dieses Syndrom nicht mehr gesehen zu haben. „Man kann nicht jede Patientin, die erbricht, in die Röhre schicken“, so das Statement eines anderen Hausarztes.
Depression durch Hirntumor
„Mir ist seit meiner Praxiseröffnung im Jahr 2008 schon zweimal so etwas passiert“, berichtete ein Teilnehmer: „Beide Male präsentierten sich die Patienten mit einer depressiven Symptomatik. Letztlich wurde dann ein Hirntumor gefunden. Bei einer Anorexiepatientin hätte ich allerdings nicht in diese Richtung gedacht.“
Einen ähnlichen Fall hatt eine andere Kollegin erlebt: „Bei einer 87-jährigen Ordensschwester hatten die Mitschwestern eine Wesensveränderung und eine Depression bemerkt. Antidepressiva halfen nicht. Erst nach dem fünften Klinikaufenthalt wurde erstmalig eine bildgebende Diagnostik durchgeführ, die einen großen Hirntumor offenbarte.“
Wie weit soll die Diagnostik gehen?
„Solche katastrophalen Verläufe brennen sich natürlich ins Gedächtnis ein“, kommentierte ein Hausarzt. „Trotzdem meine ich, dass man nicht bei jedem Patienten mit einer Depression nach möglichen organischen ursachen fahnden muss.“ Diese Äußerung blieb nicht unwidersprochen. „Eine organische Basisdiagnostik muss schon sein“, konterte ein Kollege. „Das ist alleine schon deshalb notwendig, um eine tragbare Arzt-Patient-Beziehung zu schaffen. Andernfalls fühlt sich der Patient möglicherweise nicht ernst genommen.“ „Ich untersuche vor allem Patienten gründlich, die lange nicht in der Sprechstunde waren oder bei denen die Depression ungewöhnlich verläuft oder nicht auf Antidepressiva anspricht“, ergänzte ein ärztlicher Seminarteilnehmer. „Wenn mir ein Angehöriger oder Bekannter erzählt, der Patient sei "anders als sonst", müssen die Alarmglocken läuten.“
Wie häufig kommt es überhaupt vor, dass ein Hirntumor als endogene Depression verkannt wird? Je nach den eigenen Erfahrungen beurteilten das die Braungruppen-Teilnehmer unterschiedlich. „Ich erlebe es öfter, dass mich Patienten wegen psychischer Symptome konsultieren und dann eine organische Ursache gefunden wird“, berichtete ein Kollege. er erinnerte sich an einen Mann, der über Depressionen und ständige Müdigkeit klagte und bei dem dann ein Hypophysentumor gefunden wurde. Das Fazit der Kollegen: „Man muss immer wachsam sein.“
Das Dilemma dabei, das ein anderer Hausarzt zu bedenken gab: „Man kann einem Patienten durch zu umfangreiche Diagnostik auch schaden, indem man ihn auf eine organische Ursache fixiert, obwohl er ein rein psychisches bzw. psychosomatisches Problem hat.“
Umgekehrtes Problem
„Meiner Meinung nach ist es häufiger umgekehrt, nämlich dass sich eine Depression in Form von körperlichen Beschwerden äußert und man erst nach einem ausführlichen Gespräch diese Zusammenhänge aufdecken kann. Ich kann so etwas sehr schnell erkennen und mir so aufwendige und nutzlose Organdiagnostik sparen“, meinte ein Kollege
„Um mich nicht vorzeitig festlegen zu müssen, schreibe ich in der Regel "Bild einer Depression". So ist man gezwungen, den Verdacht gegebenenfalls immer wieder infrage zu stellen“, lautete ein weiterer Kommentar.
Ein Kollege plädierte für eine pragmatische Lösung: „Ich versuche, alle meine Patienten regelmäßig zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge zu motivieren. Bei dieser Gelegenheit würden sich dann eventuell Diagnosen, an die ich bislang nicht gedacht habe, offenbaren.“
Was meint der Patient?
„Wir müssen den abwendbar gefährlichen Verlauf erkennen oder zumindest bedenken“, mahnte Prof. Mader. „Können uns die Leitlinien der DEGAM vielleicht dabei helfen?“ „Durchaus“, meldete sich ein DEGAM-Mitglied zu Wort und brachte ein Beispiel: „In der DEGAM-Leitlinie "Brustschmerz" wird auf den Marburger Herzscore verwiesen, der dazu beiträgt, die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit als Ursache eines Brustschmerzes einzuschätzen. Eines der Kriterien, die sich als maßgeblich für diese Einschätzung erwiesen haben und deshalb Eingang in den Score fanden, ist die Selbsteinschätzung des Patienten. Vermutet er selbst eine Herzkrankheit als Ursache seiner beschwerden, ist die Diagnose tatsächlich wahrscheinlicher. Möglicherweise lässt sich diese Selbsteinschätzung ja auf andere Beschwerdekomplexe übertragen. Wir sollten unsere Patienten vielleicht öfter mal frage: Welche Ursache vermuten Sie denn?“
Dr. med. Vera Seifert
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2013; 35 (1) Seite 28-29
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf doctors.today publiziert.
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).