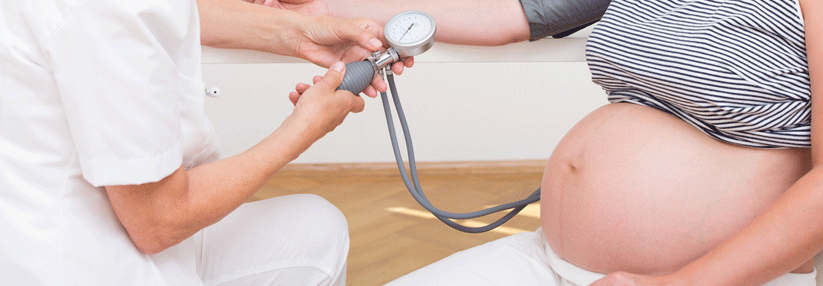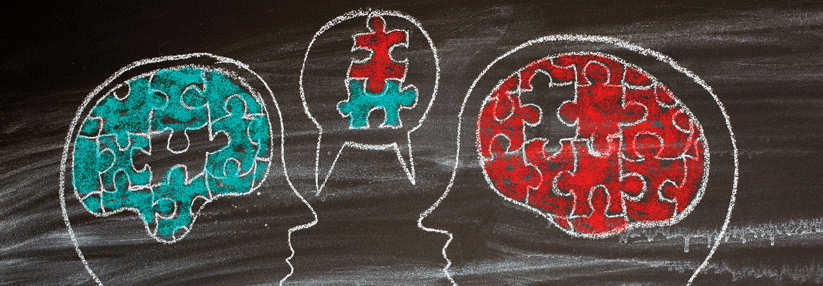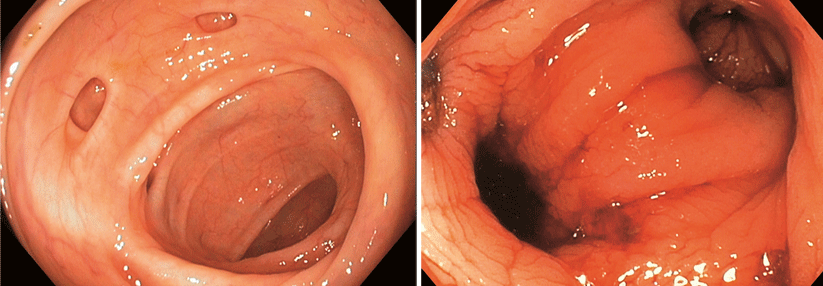Wenn das Glücksspiel zum Gesundheitsrisiko wird
 Zu den negativen Auswirkungen der Zockerei zählen unter anderem Verschuldung, Arbeitslosigkeit, Verlust der sozialen Kontakte und sogar Suizid.
© SpicyTruffel/gettyimages
Zu den negativen Auswirkungen der Zockerei zählen unter anderem Verschuldung, Arbeitslosigkeit, Verlust der sozialen Kontakte und sogar Suizid.
© SpicyTruffel/gettyimages
Durch die liberalere Gesetzgebung zum Thema „Gambling“ im Jahr 2005 in Großbritannien, leichteren Zugang und einschlägige Werbung stiegen immer mehr Menschen ins Glücksspiel ein. Heute sind laut einer offiziellen Schätzung etwa 15 % der Erwachsenen in Großbritannien von negativen Auswirkungen der Zockerei betroffen. Dazu zählen unter anderem Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Kriminalität, der Verlust von sozialen Beziehungen, häusliche Gewalt und sogar Suizid. Nur ein kleiner Anteil von ihnen erhält derzeit professionelle Unterstützung.
Das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) hat kürzlich eine Guideline dazu veröffentlicht. Es geht um Identifikation, Beurteilung und Management von Problemen bzw. Erkrankungen, die mit Glücksspielen assoziiert sind. Die entscheidenden Punkte der neuen Guideline fassen Jennifer Francis et al. vom NICE in Manchester zusammen.
Neben Rauchen und Alkohol auch nach Glücksspiel fragen
Genau wie in einem umfassenden Patientengespräch Rauchen und der Konsum von Alkohol und anderen riskanten Substanzen angesprochen werden, sollen Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich erwägen, nach Glücksspiel zu fragen. „Spielen Sie um Geld?“ oder „Machen Sie sich Sorgen darum, dass Sie selbst oder eine andere Person Glücksspiele machen?“
Patientinnen und Patienten mit bestimmten Erkrankungen oder Lebensumständen können ein erhöhtes Risiko für die möglichen negativen Auswirkungen des Glücksspiels haben. Das Autorenteam führt einige Faktoren Betroffener auf, bei denen Ärztinnen und Ärzte hellhörig werden sollten:
- psychische Erkrankungen (Depression, posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, AD(H)S, Suchterkrankung, Suizidalität)
- positive Familienanamnese bzgl. Substanzabhängigkeit
- Straffälligkeit, Obdachlosigkeit, finanzielle Probleme, (familiäre) Gewalt
- eingeschränkte Impulskontrolle durch verordnete Medikamente, z. B. Dopaminergika bei Parkinson oder Aripiprazol als Antipsychotikum
- neurologische Erkrankungen oder Hirnschäden
- besondere Belastungen (z. B. junge Erwachsene, die von zu Hause ausziehen) und Angehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen (Armee, Profisport, Finanzsektor, Glücksspielindustrie)
Fragen, zuhören, beraten und Hoffnung geben – dies sind Wünsche von Betroffenen, wie eine spielsüchtige Patientin rückblickend beschreibt. Wie also können Ärztinnen und Ärzte unterstützen? Zunächst geht es um Aufklärung. Betroffene sollen über mögliche Risiken des Zockens informiert werden, insbesondere über die Gefahr der Suizidalität. Erscheint die betroffene Person unmittelbar gefährdet, ist eine direkte Überweisung in eine Klinik oder zu einer Fachärztin bzw. einem Facharzt nötig.
Hinweise zu Hilfsangeboten und Unterstützung geben
In einer nicht akuten Situation helfen auch Informationen zur Kontrolle des eigenen Handelns. Software für Online-Spiele sollte blockiert, Geldüberweisung verhindert und der bloße Zugang zum Geld fürs Zocken unmöglich werden. So könnte eine vertraute Person die Finanzen der bzw. des Betroffenen kontrollieren. Neben der Motivation zur Verhaltensänderung sind Hinweise zu Hilfsangeboten wichtig. Diese können von geeigneten Websites über telefonische Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen bis zu speziellen Therapieangeboten reichen.
Als dienlich hat sich die kognitive Verhaltenstherapie durch entsprechend geschulte Therapeutinnen und Therapeuten erwiesen. Sie ist in der Gruppe besonders wirkungsvoll bei problematischem Spielen und zudem kosteneffektiv. Hilfreich sind darüber hinaus Angebote zur sozialen, finanziellen, juristischen oder beruflichen Unterstützung.
In einem Kommentar benennt ein Autorenteam um Prof. Dr. Sean Cowlishaw von der Monash University Melbourne Schwachpunkte der Guideline: Zum einen sei ein allgemeines Screening bzgl. Glücksspiel kritisch, es fehle dafür u. a. an Evidenz. Zum anderen dürfe man von derartigen Empfehlungen auch umfassende Vorschläge zur Prävention erwarten. Dazu gehören – ähnlich wie bei Anti-Rauchkampagnen – Maßnahmen zur Einschränkung des Glücksspiels sowie mehr Aufklärung zu den assoziierten Risiken.
Quellen:
1. Francis J et al. BMJ 2025; 388: r323; DOI: 10.1136/bmj.r323
2. Cowlishaw S et al. BMJ 2025; 388: r447; DOI: 10.1136/bmj.r447
3. Acton S. BMJ 2025; 388: r331; DOI: 10.1136/bmj.r331
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).