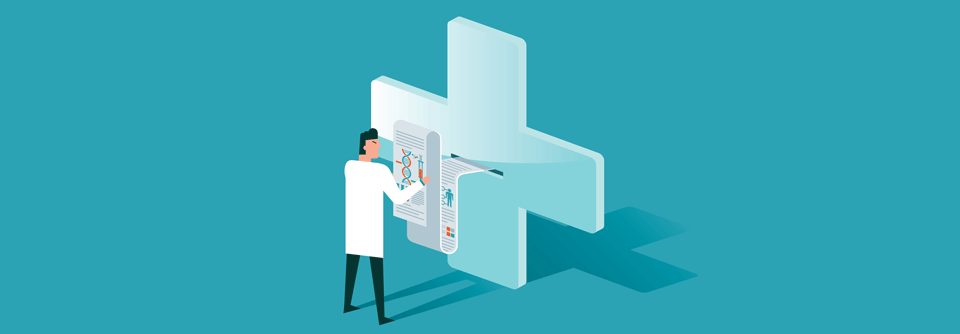
Über Datenspende aufklären Vertrauen in Ärzt:innen als Schlüsselrolle
 Eine vertrauliche Beziehung zum/zur Arzt/Ärztin spielt eine wichtige Rolle, wenn Patient:innen über die Verwendung sensibler Daten für Forschungszwecke entscheiden.
© SFIO CRACHO – stock.adobe.com
Eine vertrauliche Beziehung zum/zur Arzt/Ärztin spielt eine wichtige Rolle, wenn Patient:innen über die Verwendung sensibler Daten für Forschungszwecke entscheiden.
© SFIO CRACHO – stock.adobe.com
Forschende, Ärzte, Ethiker, Datenschützer und Juristen – um die Nutzung von Patientendaten zu Forschungszwecken zu diskutieren, setzte der Deutsche Ethikrat beim Forum Bioethik zur „Patientenorientierte Datennutzung“ auf Interdisziplinarität vom Feinsten.
„Die unterschiedlichen Standorte von Versorgung und Forschung“, betonte in diesem Zusammenhang Prof. Dr. phil. Dirk Lanzerath, Leiter des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften und stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Es handele sich um Handlungsräume, die unterschiedlichen rechtlichen und ethischen Regeln unterliegen, aus unterschiedlichen Quellen finanziert werden und jetzt durch Datentransfer miteinander verschränkt werden.
Und während Versorgung individuelle Diagnose und Therapie zum Ziel habe, verfolge Forschung die Generierung von begründetem und gerechtfertigtem Wissen. Dabei entstehe zwangsläufig „eine Spannung zwischen der Logik des Heilens und der Logik des Forschens“.
Wer dokumentiert, ist nicht gleichzeitig beim Patienten
In diesem Spannungsfeld könne das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt angegriffen werden. So könne der Dokumentationsaufwand für die Forschung etwa zulasten der Kontaktzeiten zwischen Arzt und Patient gehen und damit zulasten der Versorgungsqualität. Das Vertrauensverhältnis könne außerdem gestört werden, wenn sich Patienten nicht ausreichend über Nutzen und Risiken der sekundären Datenverbindung aufgeklärt fühlen.
„Je sensibler und diskriminierungs- und stigmatisierunganfälliger die Daten sind, desto mehr explizite Zustimmung ist notwendig“, betont Prof. Lanzerath. Und desto weniger Zustimmung eingebaut ist, desto lebendiger müssten dann robuste Absicherungsmechanismen in der Architektur des datenverarbeitenden Systems sein.
Besondere Aufmerksamkeit verdienten dabei potenziell stigmatisierende Daten wie etwa genetisch psychiatrische Diagnostik, wenn sie im Jugendalter erhoben werden und später möglicherweise partizipative Probleme bewirken. Das Gleiche gelte für Informationen über stigmatisierende Infektionen wie etwa HIV. „Bei solchen Fällen kommt Ärztinnen und Ärzten eine besondere Verantwortung zu, über die Risiken der Datenweitergabe aufzuklären.“
Ärzte hätten generell eine wichtige Rolle, was das Systemvertrauen in der Versorgung betrifft. „Im Aufklärungsgespräch muss klar kommuniziert werden, dass die Forschungsnutzung die aktuelle Behandlung nicht verändert“, so Prof. Lanzerath.
Trotz Werbung für Datenspenden im Arzt-Patienten-Gespräch müsse klar sein, dass keine Nachteile in der Versorgung entstehen, wenn der Patient nicht einwillige. „Patienten dürfen auf keinen Fall das Gefühl bekommen, das Arzt-Patienten-Verhältnis könnte zu einer Art gläserner Raum werden und sie könnten Beschwerden und Sorgen nicht mehr offen kommunizieren“, warnt Prof. Lanzerath vor dem Hintergrund, dass es Studien gebe, die solche Tendenzen belegen.
Das Arzt-Patienten-Verhältnis müsse weiterhin ein geschütztes Verhältnis sein. Gleichzeitig müssten aber auch Ärztinnen und Ärzte das Gefühl haben, dass sich ein zusätzlicher Dokumentationsaufwand lohnt und die Zeit dafür keine vergeudete ist. „Und das ist nicht damit geregelt, dass man sich Modelle überlegt, wie die Zeit zusätzlich vergütet werden kann.“ Das sei ein sekundärer Aspekt.
Medical-Tribune-Bericht



