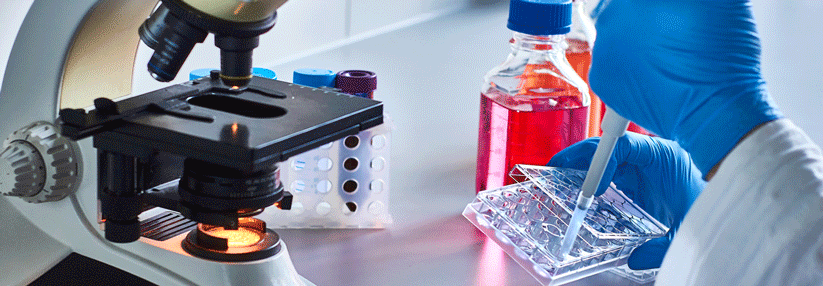Damit Wissenschaft etwas verändern kann, muss sie auch öffentlich wirken
 Auch die Ernährungspolitik hat Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung.
© Creativa Images – stock.adobe.com
Auch die Ernährungspolitik hat Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung.
© Creativa Images – stock.adobe.com
Wie kann die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt erhalten und verbessert werden? In welcher Form können sich die dafür Zuständigen besser vernetzen? Wie findet die Wissenschaft mehr Gehör in der Öffentlichkeit? Zu diesen Fragen trafen sich Ende Januar 300 Vertreter von Universitäten, öffentlichen Instituten, Verbänden, Ministerien und aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst in Berlin. Mit dabei war auch die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten, DANK, vertreten durch die Sprecherin und DDG-Geschäftsführerin Barbara Bitzer sowie den ehemaligen DDG-Geschäftsführer und Beauftragten des Vorstands Dr. Dietrich Garlichs.
Ziel des einmal jährlich tagenden Zukunftsforums ist die Entwicklung einer gemeinsamen Public Health-Strategie für Deutschland. Wie diese aussehen könnte, diskutierten die Teilnehmer in zwölf Arbeitsgruppen, unter anderem zu Kinder- und Jugendgesundheit, Arbeitswelt, Kommunen und Big Data.
In der AG „Verhältnisprävention auf Bevölkerungsebene: Strategien politischer Durch- und Umsetzung“ stellte Bitzer die Arbeitsweise und Erfolge von DANK vor. Das Wissenschaftsbündnis verbreitet zum einen Wissen über wirksame Maßnahmen, etwa gegen Übergewicht, und initiiert selbst Studien. Es sorgt aber auch durch öffentlichkeitswirksame Aktionen für direkten Druck auf die Politik. „Diese beiden Ebenen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich“, betonte Bitzer.
Einige Teilnehmer wandten ein, dass es schwer sei, die Medien für Gesundheitsthemen zu interessieren. Dem widersprach eine anwesende Tageszeitungs-Redakteurin deutlich: „Wir sind dafür sehr offen.“ Allerdings brauche es die Initiative aus der Wissenschaft.
Unzufrieden mit Klöckners Reduktionsstrategie
Diskutiert wurde auch die Frage, warum wissenschaftliche Evidenz oft keinen Eingang in politisches Handeln findet. Maria Becker, Leiterin der Unterabteilung Prävention im Gesundheitsministerium, verwies darauf, dass Politik immer einen Ausgleich verschiedener Interessen finden müsse.
Deutlich wurde, dass sich viele AG-Teilnehmer ein aktiveres Eintreten des Gesundheitsministeriums für gesundheitliche Interessen wünschen. Dies gilt auch für Themen, die in die Zuständigkeit anderer Ministerien fallen, wie etwa Ernährung, das derzeit gemeinsam mit Landwirtschaft in einem Ministerium angesiedelt ist. Viele Anwesende zeigten sich unzufrieden mit der Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz, die unter Federführung von Ernährungsministerin Julia Klöckner im Konsens mit der Industrie erarbeitet wurde. Hilfreich wäre, so die übereinstimmende Meinung, wenn das Thema Ernährung in der nächsten Legislaturperiode dem Gesundheitsministerium zugeschlagen würde.
Durchaus kontrovers diskutiert wurde auch die Frage, ob sich Wissenschaftler überhaupt politisch zu Wort melden sollten. Bitzer verwies hier auf eine Erklärung des „Lancet“, des wohl renommiertesten Medizin-Journals weltweit. „Wissenschaft ist nur relevant, wenn sie eine Wirkung auf das Leben der Menschen hat“, heißt es darin. „Es reicht nicht, eine hervorragende Studie zu veröffentlichen. Es braucht auch Entwicklung von Maßnahmen, öffentliche Mobilisierung und Einmischung. Wir treten ein für die Idee, dass Wissenschaft etwas verändern kann und muss.“
Globaler, wissensbasierter, handlungsorientierter Ansatz
Auch in anderen Arbeitsgruppen wurde deutlich: Häufig fallen Entscheidungen, die großen Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung haben, in nicht-gesundheitlichen Politikfeldern. Beispiele dafür sind die Themen Feinstaub, Fahrradfahren, Schulessen oder Bildung.
„Um mehr Gesundheit für alle zu erreichen, muss Gesundheit ein Querschnittsthema in allen Politikfeldern werden“, sagt Susanne Moebus, Professorin für Urbane Epidemiologie des Universitätsklinikums Essen. „Die Cholera wurde vor allem durch sauberes Wasser und ein funktionierendes Abwassersystem besiegt. Wir brauchen heute einen globalen Ansatz, der wissensbasiert und handlungsorientiert ist, eine weltweite Perspektive einnimmt und gleichzeitig Gesundheit in den vielen nur scheinbar kleinen politischen Entscheidungen vor Ort mitdenkt.“
Quelle: 3. Zukunftsforum Public Health