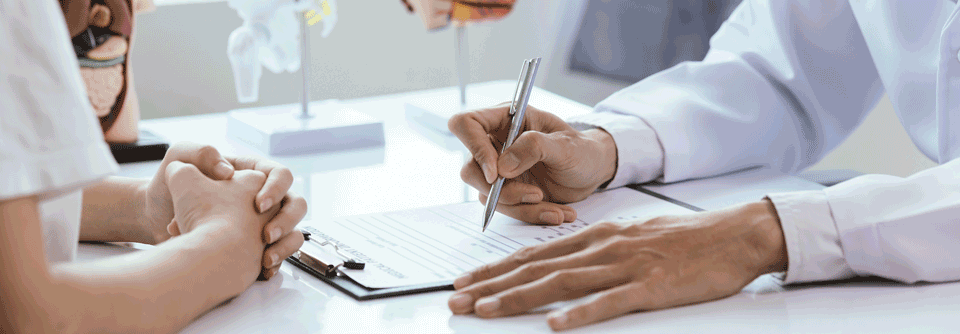Fluch und Segen zugleich Digitale Technik erleichtert den Praxisalltag – und schafft neue Probleme
 Nicht alle Menschen mit Diabetes benötigen eine Psychodiabetologie, jedoch kann es in einigen Fällen durchaus sinnvoll sein.
© kinara art design – stock.adobe.com
Nicht alle Menschen mit Diabetes benötigen eine Psychodiabetologie, jedoch kann es in einigen Fällen durchaus sinnvoll sein.
© kinara art design – stock.adobe.com
Vorbestehende Persönlichkeitsmerkmale oder einschneidende Lebensereignisse könnten das Erleben von Diabetestechnologie beeinflussen, wie die Psychologische Psychotherapeutin Dipl-Psych. Susanne Baulig, Mainz, berichtete. Die Technik werde oft als Hilfe und Bürde zugleich empfunden: „Wir können uns gar nicht oft genug klarmachen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die ein sehr individuelles Erleben von Diabetes und Technik mitbringen.“ Sie schilderte dies anhand von zwei Fallbeispielen.
Eine junge Frau möchte ihren Diabetes perfekt managen
Die erste Patientin, eine 25-jährige Jurastudentin, zeichnete sich durch ein sehr hohes Leistungsideal und perfektionistische Züge aus. Sozial hingegen war sie nur wenig eingebunden: „Da fand im Alltag wenig statt, das Anlass für gute Stimmung bot“, berichtete die Psychotherapeutin. Mit ihrem HbA1c-Wert von 5,7 % war die Diabetologin der Patientin zwar hochzufrieden – doch seit die junge Frau die kontinuierliche Glukosemessung (CGM) nutzte, kontrollierte sie permanent ihre Werte, sodass ihr Alltag sich vorwiegend um die Glukosekontrolle und -korrektur drehte.
Mithilfe der Psychotherapie sei es ihr gelungen, ihr Leistungsideal kritisch zu hinterfragen. „Gleichzeitig haben wir überlegt, welche positiven Aktivitäten sie in ihren Alltag einbauen kann, um ein Gegengewicht zum alles beherrschenden Diabetes zu schaffen“, berichtete Baulig. Die Patientin erfüllte sich dann den lang gehegten Wunsch, Reitunterricht zu nehmen, knüpfte neue soziale Kontakte und schaffte es, ihre Sensorwerte nicht mehr an erster Stelle zu sehen.
Eine Frau mit PTBS möchte nicht von Technik kontrolliert werden
Beim zweiten Fall handelte es sich um eine 41-jährige Frau mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) aufgrund von massiven Gewalterfahrungen in ihrer vorigen Ehe. Diese hätten ihre Einstellung gegenüber ihrem Diabetes verändert, sagte die Psychotherapeutin. „Sie wollte nicht mehr, dass irgendwer oder irgendwas sie im Alltag kontrolliert. Daraus entstand Misstrauen gegenüber ihrem AID-System, das ihr die Therapie abnehmen sollte.“ Gemeinsam mit der Patientin habe sie dann ein Störungsmodell erarbeitet, um herauszufinden, wie PTBS und Diabetestechnik zusammenhängen.
„Wir haben immer wieder diskutiert, ob es ihr ohne Technik besser gehen würde, allein damit die Option mal zur Sprache kommt“, erzählte Baulig. Die Patientin sei einerseits sehr modebewusst gewesen und habe die Pumpe als Störfaktor empfunden. „Doch sie sagte auch: Ich sehe ja die Zahlen, ohne AID würde ich das wohl nicht so gut hinkriegen, deshalb entscheide ich mich trotz der Schwierigkeiten für die Technik.“
Bei den beiden geschilderten Fällen seien Langzeittherapien mit jeweils 60 Therapiesitzungen erforderlich gewesen. Baulig betonte aber auch, dass nicht alle Menschen mit Diabetes im Falle psychischer Erkrankungen oder Störungen eine Psychodiabetologie benötigen. Bei speziellen Indikationen wie Essstörungen, Hypoglykämieangst oder einem ambivalenten Verhältnis zu Diabetestechnik brauche es aber spezielle Expertise.
„Probleme zu lösen ist leichter, als mit ihnen zu leben“
Auch die Diabetesberaterin Claudia Sahm aus Herrsching hat die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Diabetes einerseits eine sehr positive Einstellung zur Digitalisierung haben, die Technologien aber gleichzeitig auch nicht selten als Belastung erleben. Deshalb sei es zwar wichtig, die stetig wachsenden Datenmengen strukturiert zu analysieren. „Gleichzeitig aber müssen wir uns bei der Analyse klarmachen, dass das Leben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden wird. Probleme zu lösen, ist nun einmal leichter, als mit ihnen zu leben.“ Ihre Tipps:
- Loben statt kritisieren: Statt sich auf problematische Werte zu fokussieren, sollten positive Aspekte hervorgehoben werden. „Beim Blick auf Tagesprofile neigt man dazu, vor allem die Spitzen zu sehen und danach zu fragen – das sollten wir uns abgewöhnen.“
- Gemeinsame Analyse des AGP: Man sollte die vorhandenen Daten nutzen, um ins Gespräch zu kommen – etwa, indem man einmal gezielt nur die Alarmprotokolle anschaut: „Ui, da hat es aber viel gebimmelt!“
- Langfristige Vergleichsdaten: Der Vergleich mit früheren Glukoseverläufe hilft, Fortschritte sichtbar zu machen. Dafür am besten den Bildschirm drehen und den Menschen mit Diabetes fragen, was er darin sieht – „Und dann selbst die Klappe halten!“
Quelle: Diabetes Herbsttagung 2024