
INUKA-Projekt in Tansania „Eine aktive Strategie gegen Armut“
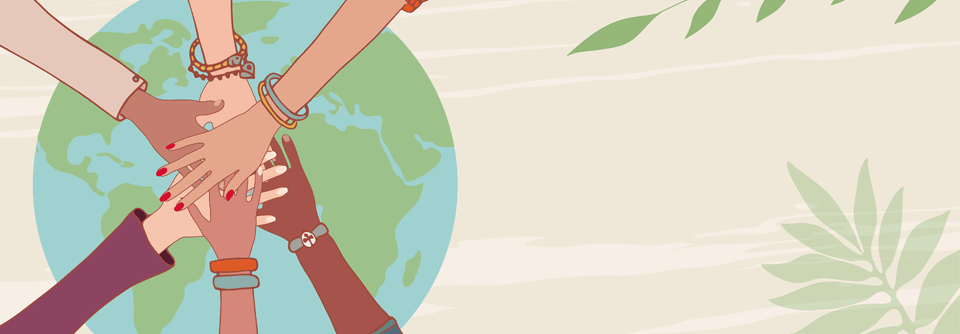 Durch die Arbeit von Dr. Oliver Henke als Entwicklungshelfer in Tansania entstand das INUKA-Projekt, das auf die langfristige und nachhaltige Verbesserung der Palliativmedizin abzielt.
© melita – stock.adobe.com
Durch die Arbeit von Dr. Oliver Henke als Entwicklungshelfer in Tansania entstand das INUKA-Projekt, das auf die langfristige und nachhaltige Verbesserung der Palliativmedizin abzielt.
© melita – stock.adobe.com
Wenn man an Erkrankungen in Afrika denkt, kommen einem sehr wahrscheinlich zunächst Infektionskrankheiten in den Sinn. Aber auch Krebs ist ein großes Problem – wobei die offiziellen Zahlen gar nicht so hoch sind, sagt Dr. Oliver Henke, Arbeitsgruppenleiter Global Oncology am Universitätsklinikum Bonn. „Im Jahr 2020 betrug die Krebsinzidenz in Afrika knapp eine Million – das ist in der Tat nicht viel, wenn man die Gesamtbevölkerungszahl von 1,3 Milliarden Menschen betrachtet.“ Ungefähr 700.000 Patient:innen starben an einem Tumor. Aber: „Viele Fälle werden nicht erkannt, weil die Diagnostik schlichtweg zu viel kostet und die entsprechende Infrastruktur fehlt.“ Deshalb dürfte die Dunkelziffer sehr hoch ausfallen. „Als ich 2016 in Afrika arbeitete, wurden z.B. in dem lokalen Krebsregister der Kilimanjaro Region keine Leukämien aufgelistet, weil es niemanden gab, der diese diagnostizieren konnte“, berichtet der Onkologe.
Laut Prognosen der Weltgesundheitsorganisation werden 28 Millionen Menschen im Jahr 2040 die Diagnose Krebs erhalten – in Ländern mit niedrigem Human Development Index wird sich die Inzidenz im Vergleich zum Jahr 2020 verdoppeln. „Das ist bereits jetzt eine große Public-Health-Herausforderung, die sich in Zukunft noch verschärfen wird“, betont Dr. Henke.
Ein nicht endender Teufelskreis
Erschwerend kommt hinzu: Eine einheitliche Krankenversorgung gibt es in Afrika nicht. Während in manchen afrikanischen Ländern eine gute Basisversorgung existiert, müssen Patient:innen in anderen Teilen des Kontinents fast alles aus eigener Tasche zahlen. „Zum Beispiel haben in Tansania 28 % der Bevölkerung eine Krankenversicherung – allerdings verfügen nur 10 % über solch eine, die eine Behandlung bei Spezialist:innen finanziert. Das heißt, 90 % der Tansanier:innen sind nicht gegen Krebs oder andere Krankheiten, die an einer Fachklinik behandelt werden müssen, versichert“, sagt Dr. Henke.
Und: Viele Menschen in Afrika haben nahezu keine guten Erfahrungen mit Schulmedizin bei Krebs gemacht. Die Patient:innen erhalten zwar eine Therapie – weil die Erkrankung aber so spät diagnostiziert wird, sterben sie dennoch daran. „Das, was das Umfeld davon mitnimmt, ist: Krebs kann nicht geheilt werden, die Medikamente sind teuer und am Ende stirbt man trotz Therapie. Das heißt, Patient:innen mit einem Tumor werden alles dafür tun, um nicht ins Krankenhaus zu kommen, da sie denken, dass sie dann arm werden und sterben.“ Die Betroffenen gehen daher oftmals erst zu lokalen Heiler:innen. Erst, wenn deren Behandlung fehlschlägt, stellen sich die Patient:innen in einer Klinik vor. Dann ist die Erkrankung meist so weit fortgeschritten, dass sich der Teufelskreis schließt.
Umso wichtiger erscheinen eine palliativmedizinische Versorgung und entsprechende Aufklärung. „Ungefähr die Hälfte der Länder in Subsahara-Afrika hat eine palliativmedizinische Struktur. Das bedeutet aber nicht, dass es flächendeckend ist“, berichtet der Experte. So ergab eine Studie aus dem Jahr 2016, dass nur 5 % der Menschen in Subsahara-Afrika Zugang zu einem palliativmedizinischen Service hatten.
Armut verschärft sich durch die aktuellen Strukturen
Das ist nicht nur ein medizinisches Problem; vielmehr verschärft sich dadurch die Armut, die in den Ländern herrscht. „Stellen wir uns eine Patientin oder einen Patienten im Stadium IV vor, die bzw. der nicht geheilt werden kann. Gibt es keine palliativen Versorgungsstrukturen, kann man die Person nur mit einer Chemo- oder Antikörpertherapie behandeln oder sie zur Bestrahlung schicken. Die Familie versucht dann verständlicherweise, die Therapien zu ermöglichen. Studien zeigen, dass die Angehörigen dafür alles veräußern würden, was sie besitzen, sei es Land, Vieh oder Hochzeitsmitgift. Teilweise nehmen sie ihre Kinder aus der Schule, weil die Gebühren nicht mehr bezahlt werden können.“
Am Ende stirbt die Patientin oder der Patient dennoch – und die Familie bleibt in Armut zurück. „Die Palliativmedizin bietet den Betroffenen eine Alternative und sie ist eine aktive Strategie gegen die Armut.“
Dr. Henke widmet sich dem Aufbau von palliativmedizinischen Strukturen in Tansania. Er selbst lebte mit seiner Familie von 2016 bis Ende 2021 in Afrika und arbeitete dort als Entwicklungshelfer. Während seine Frau, Dr. rer. medic. Antje Henke, als Gesundheitswissenschaftlerin große Aufklärungs- und Screeningkampagnen leitete, bauten er und seine Kolleg:innen eine onkologische Station am Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi, Tansania, auf. Von Anfang an war klar, dass darüber hinaus eine palliativmedizinische Versorgung benötigt wird. „Aus der HIV-Zeit existierten bereits entsprechende Strukturen und es gab Krankenschwestern und -pfleger mit palliativmedizinischer Ausbildung. Diese lag aber schon viele Jahre zurück und es fehlten Gelder, um die Ausbildung zu erneuern“, erläutert Dr. Henke.
Die Abteilung Global Health am Uniklinikum Bonn
Euro gefördert wird, erfolgt in Kooperation mit dem Dt. Institut für Ärztliche Mission und der Sektion Global Health des Universitätsklinikums Bonn. Letztere umfasst drei Arbeitsgruppen: Global Surgery, Global Child Health und Global Oncology. In allen arbeiten Ärzt:innen mit einer ähnlichen Erfahrung wie Dr. Henke sie hat – mit Einsatz in Afrika und anderen Kontinenten. Die Kolleg:innen koordinieren die Arbeit, die sie vor Ort begonnen haben, aus Bonn heraus, meist über Drittmittelprojekte, Ausbildung oder über Capacity Building vor Ort.
Sie können das Projekt unterstützen:
bit.ly/Palliativmedizin_Nordtansania
Über kleinere Finanzierungen wie Spenden und Projektmittel versuchte das Team, die Versorgung zu ermöglichen. „Anfangs fuhren wir mit unserem Privat-PKW zu den Patient:innen und evaluierten den Bedarf. Die ersten Jahre konnten wir mit wenigen Mitteln Laienhelfer:innen bezahlen, die diese Hausbesuche übernahmen und uns Feedback gaben – was braucht der oder die Betroffene, muss er bzw. sie vielleicht in eine Klinik?“ Auch basale Schmerzmedikamente wurden kostenfrei verteilt. Das Projekt entwickelte sich gut und über die Zeit schlossen sich immer mehr Krankenhäuser an.
Als Dr. Henkes Entwicklungshelferzeit in Afrika zu Ende ging, stellte das Team mit dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission einen Projektantrag. Ziel war nicht nur die Weiterführung des laufenden Projekts, sondern auch die Erweiterung um zwei Krankenhäuser, die Einführung einer Capacity-Building-Komponente und die Schaffung einer Perspektive für Nachhaltigkeit.
INUKA-Projekt vereint verschiedene Ziele
Alle Ziele werden im INUKA-Projekt („INUKA“ = „auferstehen, loslegen“) vereint, dessen Finanzierung im Jahr 2022 mithilfe der Else Kröner Fresenius Stiftung offiziell startete: Die Hausbesuche durch die Community Health Workers werden weitergeführt, die Medikamentenversorgung steht und am Kilimanjaro Christian Medical University-College in Moshi gibt es einen Postgraduiertenkurs in Palliativmedizin. „Das ist momentan der einzige Kurs in Tansania, der angeboten wird“, so Dr. Henke. Er selbst konzentriert sich zurzeit auf die Kostenkalkulation, heißt: Ergibt es für die Krankenversicherung sogar Sinn, den palliativmedizinischen Service zu übernehmen, um am Ende Geld zu sparen und den/die Patient:in besser zu versorgen?
Stand jetzt hat das Team etwa 1.600 Patient:innen zusammen mit 75 Community Health Workers an vier Standorten betreut. „Wir sehen aber nur sehr wenige versicherte Erkrankte“, betont Dr. Henke. „Wir erreichen also genau diejenige Bevölkerungsgruppe, die unterversorgt ist.“




