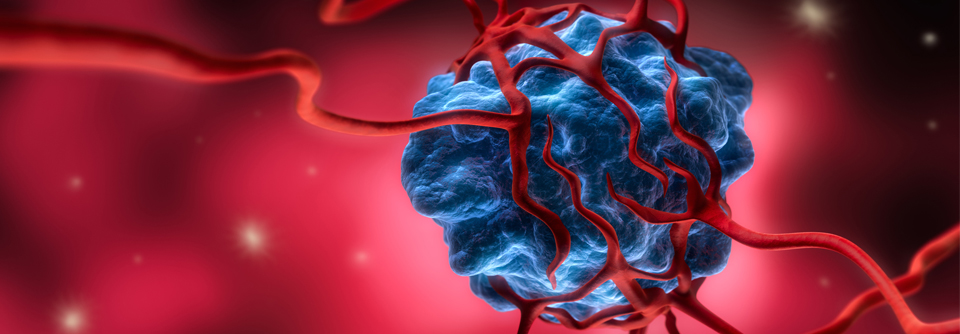JAK-Hemmer: Risikoaufklärung neu gedacht Risikoaufklärung braucht Individualität, Optimismus und vor allem Zeit
 Patientinnen und Patienten über Nebenwirkungen aufzuklären, ohne die Adhärenz zu gefährden, braucht vor allem Zeit.
© SneakyPeakPoints/peopleimages.com - stock.adobe.com
Patientinnen und Patienten über Nebenwirkungen aufzuklären, ohne die Adhärenz zu gefährden, braucht vor allem Zeit.
© SneakyPeakPoints/peopleimages.com - stock.adobe.com
Wer jemandem einen JAK-Inhibitor neu verschreibt, klärt ohne Frage über mögliche Nebenwirkungen auf. Nur kann es sein, dass der oder die Betroffene dann nach Hause geht und die Tabletten, die scheinbar doch so schlimme Nebenwirkungen haben, lieber nicht so oft einnimmt. Das liegt natürlich nicht im Sinn der Sache, so das Team um Anthony Teixera, Center for Dermatology Research, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem. Sie geben Tipps, wie sich die Skepsis vermindern lässt.
Bei der Erklärung von unerwünschten Effekten beginnt man immer mit dem Wichtigsten, so der erste Punkt der Autorengruppe. Aber die Art der Information muss an die individuelle Allgemeinbildung angepasst sein. In den USA, wo die Forschenden tätig sind, weist etwa jeder fünfte Erwachsene ein Leseverständnis auf, das unter dem eines Achtklässlers liegt. In Deutschland sind die Verhältnisse nicht dramatisch besser (Anm. d. Red.).
Diese Patientinnen und Patienten haben keinen Nutzen von Broschüren oder Flyern, die sie kommentarlos zum Nachlesen in die Hand gedrückt bekommen. Sinnvoller ist eine gut strukturierte mündliche Aufklärung – nicht in „Medizinersprech“, sondern einfache Worte in kurzen, verständlichen Sätzen. Auf eine ähnliche Situation trifft man im Gespräch mit Älteren, die z. B. schlecht hören, schlecht sehen oder bereits kognitiv leicht abgebaut haben. Mitunter lassen sich in diesen Fällen Angehörige oder Pflegekräfte hinzuziehen, die den Betroffenen dabei helfen, das Mitgeteilte zu verarbeiten und zu behalten.
Außerdem kann die Herkunft bzw. der Hintergrund der Aufzuklärenden eine Rolle spielen: Muss eine dolmetschende oder eine übersetzende Person involviert werden? Eine Erkrankung oder ein Risiko wird zudem nicht in jeder Region der Welt gleich bewertet. Mit der typischen westlichen Schulmedizin muss sich ein Patient oder eine Patientin ggf. auch erst auseinandersetzen.
Externe Informationen nicht ablehnen, um Vertrauen aufzubauen
Nicht zu unterschätzen sind selbstbeschaffte Informationen, z. B. von „Dr. Google“, sowie Erfahrungserzählungen aus dem sozialen Umfeld. Ist jemand derart „aufgeklärt“, sollte man aufmerksam zuhören, versuchen, Falschinformationen zu korrigieren und die Fakten in den richtigen Kontext zu bringen. Wer externe Informationen von vornherein strikt ablehnt, sorgt nicht dafür, dass Patientinnen und Patienten Vertrauen aufbauen, warnt die Autorengruppe.
Angepasstes audiovisuelles Material als Zusatz kann beim Verstehen unterstützen – etwa Handzettel in Einfacher/Leichter Sprache mit Piktogrammen oder Videos/Audiomaterial ggf. in der jeweiligen Muttersprache. Dies sollte auch für das mehrmalige Anschauen/Hören zur Verfügung stehen. Im Idealfall können die Betroffenen in diesem Rahmen auch Ängste adressieren. Ein kritischer Punkt im oft hektischen Praxisalltag, der sich nicht immer einfach umsetzen lässt.
Bei der Aufklärung zu Nebenwirkungen kommen generell reale Beispiele mit realen Problemen (unter Einhaltung der Schweigepflicht) besser an als das Aneinanderreihen anonymer Prozentzahlen. Außerdem heißt es, trotz ehrlicher Aufklärung optimistisch zu bleiben: Im Gegensatz zu den „3 % der Behandelten, die unter dem JAK-Inhibitor ein unerwünschtes kardiovaskuläres Ereignis entwickelten“ klingt es deutlich positiver, wenn „bei 97 von 100 Behandelten kein solches Event eintrat“.
Da JAK-Inhibitoren oft eingesetzt werden, wenn z. B. Biologika versagt haben, ist es kontraproduktiv, im Gespräch ihre (Neben-)Effekte mit ebenjenen Therapeutika oder mit für die Erkrankung nicht zugelassenen Substanzen zu vergleichen. Hervorheben sollte man stattdessen die Unterschiede gegenüber der unbehandelten Erkrankung oder realen Alternativen. Des Weiteren kann eine therapiegetriggerte Akne für die Betroffenen deutlich akzeptabler werden, wenn man hinzufügt, dass sie auf ein Ansprechen hinweist.
JAK-Inhibitoren stellen eine wichtige Therapiesäule bei diversen immunvermittelten Erkrankungen dar, betont die Autorengruppe. Es ist auch davon auszugehen, dass kontinuierlich am Sicherheitsprofil gefeilt werden wird. Die individuell angepasste Aufklärung mit Kombination verschiedener Medien könne daher dabei helfen, die Versorgung und die Therapietreue zu verbessern und damit auf die gesamte Situation betrachtet sogar Zeit sparen.
Quelle: Teixera AJ et al. JEADV Clin Pract 2024; doi: 10.1002/jvc2.551