
Interview mit Prof. Dr. Pia Wülfing „Tägliches Leiten und An-die-Hand-Nehmen entlastet Praxen und Ambulanzen“
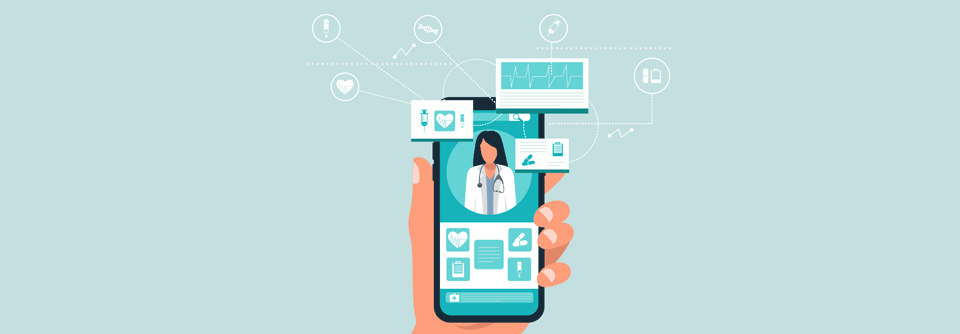 Prof. Dr. Pia Wülfing erklärt, wie digitale Gesundheitsanwendungen Mediziner:innen zukünftig unterstützen könnten.
© ANDRII – stock.adobe.com
Prof. Dr. Pia Wülfing erklärt, wie digitale Gesundheitsanwendungen Mediziner:innen zukünftig unterstützen könnten.
© ANDRII – stock.adobe.com
Was genau ist eine DiGA?
Prof. Dr. Pia Wülfing: DiGA steht für digitale Gesundheitsanwendung und wird landläufig als „App auf Rezept“ bezeichnet. Es handelt sich um Medizinprodukte bzw. technische Anwendungen, die eben digital sind. Sie sollen die Versorgung von Patient:innen verbessern, sind aber immer als Zusatz zu sehen.
Das Besondere an den DiGA ist, dass die Kosten – im Gegensatz zu gewöhnlichen Lifestyle- oder Gesundheits-Apps – von allen gesetzlichen und den meisten privaten Krankenkassen vollständig übernommen werden.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine „einfache App“ als DiGA zertifiziert wird?
Prof. Wülfing: Grundvoraussetzung ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt. Zudem müssen Datenschutz- und -sicherheitsbedingungen erfüllt sein. Auch Barrierefreiheit und Robustheit gelten als wichtige Faktoren. Und natürlich muss auch die hohe Qualität der medizinischen Inhalte nachgewiesen werden. Den größten Aufwand stellen die randomisiert-kontrollierten klinischen Studien dar. Geprüft und zugelassen werden die DiGA übrigens vom BfArM. Dementsprechend ist sichergestellt, dass sie allesamt einen medizinischen Zusatznutzen aufweisen.
Was sollte man als Ärztin bzw. Arzt über diese Anwendungen wissen?
Prof. Wülfing: Erstens einmal, dass sie budgetneutral zu verordnen sind. Für die Kolleg:innen in der Niederlassung ist das wichtig zu wissen. Außerdem können alle Mediziner:innen eine DiGA verschreiben, egal ob niedergelassen oder in der Klinik. Wenn die Kliniken nicht an der ASV teilnehmen, kein MVZ sind und keine Spezialambulanz haben, können sie über das Entlassmanagement agieren. Selbst Rehakliniken und Psychotherapeut:innen haben die Möglichkeit, zu verordnen. Falls keine Kassenrezepte vorhanden sind, kann man sich auch direkt an die DiGA-Hersteller wenden oder die Patient:innen an die Krankenkasse verweisen. Sobald diesen eine gesicherte Diagnose vorliegt, können sie auch ohne Rezept eine Kostenübernahme für die DiGA genehmigen. Zudem möchte ich betonen, dass durch die Nutzung einer DiGA keine zusätzliche Arbeit für die Ärzt:innen anfällt. Ich glaube, das ist noch ein verbreiteter Mythos.
Nutzer:innen zufriedener als bei gewöhnlichen Gesundheits-Apps
DiGA werden offenbar positiver empfunden als nicht-zertifizierte Gesundheits-Apps. Das ist das Ergebnis einer kürzlich publizierten Erhebung. Verglichen wurden 15 DiGA und 50 nicht zu verschreibende Gesundheits-Apps. Bei der üblichen Sternchenvergabe im App Store schnitten die digitalen Gesundheitsanwendungen mit 3,82 vs. 3,77 (Android) bzw. 3,78 vs. 3,53 (iOS) besser ab als andere Gesundheits-Apps (p < 0,01). Weniger zufrieden waren die DiGA-Nutzer:innen z.B. im Zusammenhang mit Softwarefehlern und der schwerfälligeren Registrierung.
Vor allem drei Punkte wurden auf der postiven Seite vermerkt:
- Kundendienst vorhanden
- Personalisierte Inhalte
- Einfache Nutzbarkeit
„Ich finde es spannend, dass die Nutzer:innen DiGA so positiv bewerten. Durch die regulatorischen Vorgaben können wir leider nicht immer alle Ideen umsetzen, da sie eventuell nicht DSGVO-konform sind oder Ähnliches. Deshalb freut es mich besonders, dass die Apps dennoch erfolgreich sind“, kommentiert Prof. Wülfing die Ergebnisse.
Quelle: Uncovska M et al. NPJ Digit Med 2023; 6: 115; DOI: 10.1038/s41746-023-00862-3
Im DiGA-Verzeichnis des BfArM sind bisher nur zwei Anwendungen in der Onkologie gelistet – beide für das Mammakarzinom. Ist in nächster Zeit mit weiteren onkologischen DiGA zu rechnen?
Prof. Wülfing: Das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich nicht nur entwicklerische, sondern auch viele regulatorische und bürokratische Hürden, die es zu überwinden gilt. Dazu zählen die bereits genannten Punkte, z.B. zur Datensicherheit. Für die Zulassungsstudien gibt es übrigens eine limitierte Zeitschiene von einem Jahr. Anders als wir es in der Onkologie gewöhnt sind, zählt deshalb nicht der primäre Endpunkt „Überleben“. Es kommt eher auf Surrogatparameter wie psychische Belastung an.
Ein weiterer möglicher Grund, warum man in der Onkologie nur wenige DiGA-Beispiele findet, sind die relativ kleinen Inzidenzen in den verschiedenen Indikationen. Eine App ist fortlaufend kostenintensiv in Entwicklung und Aktualisierung. Wenn man bedenkt, dass niemals alle Betroffenen die Anwendung nutzen werden, ist es in vielen Fällen vermutlich wirtschaftlich unsinnig, in die Anwendung zu investieren.
Es ist ja so: Man kann nicht alle Patient:innen über einen Kamm scheren und z.B. „PINK! Coach“ auch Personen mit Prostatakrebs eins zu eins anbieten. Das bedeutet, man bräuchte weitere klinische Studien, was die Kostenseite erhöht. Darüber hinaus werden die Betroffenen aus meiner Erfahrung eher unzufrieden, wenn die Angebote zu unspezifisch bleiben. Wenn man also in die Tiefe gehen will, macht jede neue Indikation einen neuen Aufwand. Dennoch denke ich, dass auch Patient:innen mit anderen onkologischen Diagnosen von demselben Konzept profitieren könnten, wie wir es bei „PINK!“ entwickelt haben.
Sind Ärzt:innen ausreichend informiert, um DiGA zu verschreiben?
Prof. Wülfing: Leider nein. Das Digitale-Versorgung-Gesetz, mit dem der Einsatz von DiGA eingeführt wurde, ist 2020 auf den Weg gebracht worden – also mitten in der COVID-19-Pandemie. Damals hatten alle Krankenhäuser, Praxen und Kliniken andere Sorgen, als sich um DiGA zu kümmern.
Ich nehme immer wieder eine Digitalisierungsmüdigkeit unter meinen Kolleg:innen wahr. Das finde ich auch in gewisser Weise verständlich, wenn man bedenkt, dass die bisher eingeführten Maßnahmen allesamt nicht reibungslos abgelaufen sind. Dazu zählen etwa die Telematik-Infrastruktur, die elektronische Patientenakte, das eRezept. In diesen Bereichen wurde es den Ärzt:innen nicht leicht gemacht.
Bei den DiGA sieht es meiner Meinung nach aber anders aus, weil die Mediziner:innen damit, wie bereits erwähnt, keine zusätzliche Arbeit erwartet. Viele dachten oder denken immer noch, dass mit Verschreibung einer DiGA zahlreiche Rückfragen und somit Mehraufwand auf sie zukommt. Das ist aber erfahrungsgemäß nicht so. Mir wird immer wieder gespiegelt, dass die Patient:innen durch die Nutzung der Apps mehr Sicherheit erlangen und deutlich weniger Fragen in die Sprechstunde mitbringen, die nicht direkt die Therapie betreffen.
Welches Feedback bekommen Sie von den Anwender:innen?
Prof. Wülfing: Die von mir mitentwickelte App „PINK! Coach“ arbeitet mit personalisierten Tageszielen. Diese Tagesziele zu erreichen, gibt den Nutzer:innen Sicherheit und das Gefühl, dass sie alles getan haben, was sie selbst beitragen können. Meiner Erfahrung nach sind Brustkrebspatient:innen generell sehr informiert und interessiert, landen während ihrer eigenen Recherche aber häufig auch bei dubiosen Quellen. Durch die App liegen ihnen leitlinienkonforme Tipps vor, was die Betroffenen entlastet. Und dieses tägliche Leiten und An-die-Hand-Nehmen entlastet dann natürlich auch die Praxen und Ambulanzen.
Interview: Dr. Judith Besseling





