
Onkologie Tipps, wie eine konstruktive Tumorkonferenz gelingt
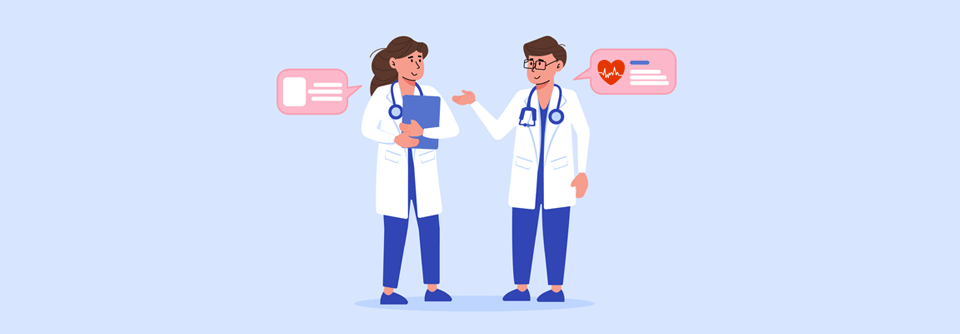 Interdisziplinäre Tumorkonferenzen verbessern die Diagnostik und Therapieplanung durch strukturierte, teamorientierte Fallbesprechung.
© Thisiseiw – stock.adobe.com
Interdisziplinäre Tumorkonferenzen verbessern die Diagnostik und Therapieplanung durch strukturierte, teamorientierte Fallbesprechung.
© Thisiseiw – stock.adobe.com
Interdisziplinäre Tumorkonferenzen können die diagnostische Genauigkeit und Behandlungsplanung verbessern, stellte Prof. Dr. Khosro Hekmat von der Uniklinik Köln gleich zu Beginn klar. Eine erfolgreiche Umsetzung beginne aber schon mit der Triage in einfache und komplexe Fälle, um letzteren mehr Zeit einzuräumen. „Muss man jede Rundherddiagnostik im Tumorboard besprechen? Meiner Meinung nach nicht.“ Teilweise bietet sich eine Vorbesprechung in kleinerer Runde an, um zu entscheiden, für welche Patient:innen standardisierte Behandlungspfade genügen. Zukünftig können eventuell Apps oder KI-Systeme bei der Selektion unterstützen.
Was zur Vorstellung der Patient:innen gehört
- Demografie (Alter, Geschlecht, Kontaktdaten)
- diagnostische Informationen (Befunde, Staging, Grading, ggf. Funktionsdiagnostik, Referenzaufnahmen)
- Fitness (ECOG), Komorbiditäten, frühere Erkrankungen, weitere Malignome, Raucherstatus
- ganzheitliche Bedarfsanalyse nach OnkoZert-Kriterien
- Patient:innenpräferenzen, z. B. Ablehnung bestimmter Therapien
- Warum wird der Fall vorgestellt?
- Behandlungsprotokolle, ggf. anwendbare Standardprotokolle
- Eignung des/der Erkrankten für klinische Studien
Eine Tumorkonferenz benötigt aus Sicht des Referenten immer einen Moderator oder eine Moderatorin, welche:r die Diskussion lenkt. Diese folgt einem geordneten Ablauf:
- Patient:innenvorstellung: Krankengeschichte und relevante klinische Daten
- Bildgebung: Erläuterung radiologischer Befunde durch Expert:innen des Fachgebiets
- Pathologie: Präsentation histologischer und molekularer Untersuchungsergebnisse
- Therapieoptionen: Diskussion möglicher Behandlungsansätze auf Basis von Evidenz
- Entscheidung und Dokumentation: Konsensfindung und strukturierte Protokollierung der Empfehlungen
Zu Beginn müssen alle relevanten Informationen und Untersuchungsergebnisse zum betrachteten Fall vorliegen (s. Kasten) und strukturiert präsentiert werden. Es nützt nichts, eine Therapie zu diskutieren, die die betroffene Person von vornherein ablehnt oder aufgrund ihres Allgemeinzustands nicht erhalten kann. Prof. Hekmat mahnte: „Deswegen ist wichtig, dass derjenige, der die Patient:innen vorstellt, diese auch kennt, und dass man die präoperative Diagnostik schon erledigt hat.“
Multidisziplinäres Tumorboard empfohlen
Wie der Chirurg betonte, sollten stets Vertreter:innen aller beteiligten Fachrichtungen zugegen sein. Dies umfasst Pneumologie, Onkologie, Chirurgie, Strahlentherapie, Radiologie, Pathologie und Nuklearmedizin. „Sonst ist es eigentlich kein multisdisziplinäres Tumorboard“, kommentierte der Experte. Als hilfreich erweise sich, wenn jemand Anwesendes den Überblick über verfügbare klinische Studien habe.
Abschließend riet Prof. Hekmat zu einer systematischen Nachverfolgung im Sinne einer Adhärenzprüfung. Der Literatur zufolge setzen die behandelnden Ärzt:innen die Empfehlung des Tumorboards zu 4–15 % aus verschiedensten Gründen nicht um. Das Ziel der Auswertung sollte darin bestehen, Behandlungspfade immer weiter zu optimieren.
Quelle:
Hekmat K. 65. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie; Vortrag „Was ist eine gute Tumorkonferenz? Gedanken und Vorschläge aus der Praxis“

