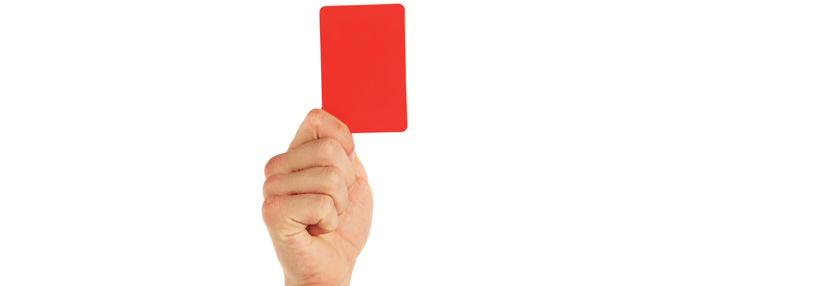Der dritte Weg neben GKV und PKV
 Mitglieder von Solidarvereinen versprechen, füreinander einzutreten.
© fotolia/fotomek
Mitglieder von Solidarvereinen versprechen, füreinander einzutreten.
© fotolia/fotomek
Dr. Harald Merckens, niedergelassener Internist in Stuttgart, war zeitlebens privat versichert. Doch irgendwann missfiel ihm das deutsche Krankenversicherungssystem mit all seinen Einschränkungen und Zwängen bei der Therapiefreiheit, der Kostenerstattung und den hohen Beiträgen und er entschied, auszusteigen. Seit nunmehr zwei Jahren ist Dr. Merckens Mitglied der Samarita Solidargemeinschaft, die sich als Alternative zur herkömmlichen Krankenversicherung versteht.
„Mir gefiel der genossenschaftliche Ansatz des Modells“, begründet der Internist seine Entscheidung. Denn anders als gesetzliche oder private Krankenversicherungen bildet die Samarita ein Netzwerk, bei dem Eigenverantwortung, Solidarität und menschliche Zuwendung im Zentrum stehen.
20 000 Menschen sichern sich selbst ab
„Unsere Mitglieder zahlen, abhängig von ihren Gesamteinkünften und der Anzahl der mit abgesicherten Personen, einen monatlichen Beitrag, der sich nach Solidargesichtspunkten errechnet“, erklärt Urban Vogel, Sprecher der Samarita und Vorsitzender der BASSG, einem Zusammenschluss von Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen mit insgesamt rund 7000 Mitgliedern. Rechnet man weitere, der BASSG nicht angeschlossene Solidargemeinschaften hinzu, haben sich bundesweit derzeit rund 20 000 Menschen für diesen dritten Weg der Absicherung im Krankheitsfall entschieden, darunter auch zahlreiche Ärzte.
Der Einstiegssatz für einen Alleinstehenden mit einem Einkommen von maximal 1500 Euro kostet bei der Samarita 265 Euro. Eine Familie mit vergleichbaren Einkünften zahlt nur unwesentlich mehr. Bei Gutverdienern mit Familie und einem Einkommen von über 8000 Euro kann der monatliche Beitrag bis zu 1050 Euro betragen. Dr. Merckens beispielsweise kostet die Samarita 30 Euro monatlich mehr als die Absicherung in der PKV. „Dafür kann ich aber darüber verfügen, für welche Behandlung ich im Regelfall das Geld verwenden möchte“, erläutert der Internist.
Antragsteller können abgelehnt werden
Das individuelle Gesundheitsrisiko und Alter werden bei der Beitragsberechnung nicht berücksichtigt. Ein Kontrahierungszwang besteht nicht. Um die Tragfähigkeit des Modells zu erhalten, kann es somit vorkommen, dass Antragsteller abgelehnt werden. Dennoch hat die Samarita eine ausgewogene soziodemografische Struktur. Das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt knapp 44 Jahre. Etwa 44 % der Mitglieder verfügen über ein Jahreseinkommen von bis zu 24 000 Euro.
Ein Teil des Mitgliedsbeitrags fließt auf ein persönliches Konto, um die Regelausgaben für Behandlungen zu decken. Der Rest wandert in einen Solidarfonds, aus dem aufwendige Therapien bei schwerwiegenden Erkrankungen bezahlt werden. Eingezahlte Beiträge, die im Verlauf eines Jahres nicht für Regelbehandlungen ausgegeben werden, wandern ebenfalls in den Solidarfonds und kommen so der Gemeinschaft zugute. „Therapien, die selbst den Solidarfonds sprengen würden, sind zusätzlich über eine konventionelle Versicherung abgesichert“, so Vogel. Da die Mitglieder nicht nach Gewinnmaximierung strebten und keine Vertriebskosten entstünden, arbeiteten die Solidargemeinschaften sehr wirtschaftlich.
Eines der grundlegenden Prinzipien der Solidargemeinschaften ist, dass die Mitglieder Anspruch auf eine umfassende Gesundheitsversorgung ohne Einschränkung bei der Therapiewahl haben. Es existiert kein definierter Leistungskatalog. „Der Patient entscheidet vielmehr gemeinsam mit dem Arzt, welche Behandlung im Einzelfall angemessen und erforderlich ist“, sagt Vogel. Somit werden z.B. auch Kosten für alternative Medizin oder Individuelle Gesundheitsleistungen erstattet.
Kostenübernahme bis zum 2,3-fachen GOÄ-Satz
Mehrmals im Jahr treffen sich die Mitglieder zudem in Regionalgruppen, um sich gegenseitig kennenzulernen, aber auch um sich bei Bedarf zu unterstützen. „Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass Mitglieder füreinander Fahrten erledigen, sich um bürokratische Angelegenheiten kümmern oder auch Hilfsmittel untereinander ausleihen“, berichtet Dr. Merckens. Bei der Kostenübernahme orientiert sich die Samarita an der GOÄ bis zum 2,3-fachen Satz. „Die Rechnung, die der Patient von seinem Arzt erhält, reicht er bei unserer Geschäftsstelle ein. Die Rechnung wird dann nach Prüfung entweder aus dessen persönlichem Konto erstattet oder aber die Geschäftsstelle überweist die Kosten zum Beispiel bei teuren stationären Behandlungskosten direkt“, skizziert Vogel den Abrechnungsweg.
Trotz all der Vorteile haben die Solidargemeinschaften jedoch mit einem großen Problem zu kämpfen, denn sie bewegen sich in einer ungeklärten Rechtssituation. Die Bundesregierung vertritt nämlich die Auffassung, dass die Mitgliedschaft in einer Selbsthilfeeinrichtung nur dann als ein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall im Sinne des SGB V gesehen werden kann, wenn hierfür ein Rechtsanspruch besteht. „Ist das nicht der Fall, unterliegen die Mitglieder der Versicherungspflicht in der gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung“, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG).
Genau diesen Rechtsanspruch aber erkennen die Gerichte bei den Solidargemeinschaften bislang nicht an. Eine rechtssichere Lösung könne daher nur durch Umwandlung in kleinere Vereine im Sinne des § 210 Versicherungsaufsichtsgesetz geschaffen werden, so das BMG.
Das aber lehnt die BASSG ab, da dies dem Solidargedanken widerspräche und zwangsläufig zu Einschränkungen bei der Auswahl der Leistungen führen würde, sagt Vogel. Die kontroverse Sichtweise zur Rechtslage hat auch zur Folge, dass die Mitgliedsbeiträge teilweise nicht als Sonderausgaben von den Finanzämtern anerkannt werden. Dabei sah es bei Gründung der BASSG im Jahr 2007 noch ganz danach aus, als würde die Bundesregierung den Solidargemeinschaften grünes Licht geben. Die damalige schwarz-rote Koalition hatte nämlich die Auffassung vertreten, dass die Einrichtungen, die zwar keine rechtlichen, aber faktische Leistungsansprüche im Krankheitsfall gewähren, eine „anderweitige Absicherung“ darstellen dürften.
Keine Konkurrenz zum Massengeschäft
Der GKV-Spitzenverband entwarf daher im Auftrag des BMG unter Leitung von Ulla Schmidt einen Anforderungskatalog, dessen Einhaltung Voraussetzung sein sollte, damit die Mitglieder einer Solidargemeinschaft die Pflicht zur Versicherung erfüllen. Das BMG stimmte dem Katalog zu.
Der PKV-Verband dagegen widersetzte sich der Veröffentlichung. Der Verband argumentierte, dass die Solidargemeinschaften aufgrund des Fehlens rechtlicher Garantien keine dauerhafte Erfüllbarkeit von Leistungsansprüchen zusichern könnten. Dadurch bestünde die Gefahr, dass deren Mitglieder doch wieder auf eine Absicherung durch GKV und PKV angewiesen seien und dort Subventionen auslösten.
Vogel ist dennoch optimistisch, dass die Solidargemeinschaften irgendwann eine gesetzliche Klarstellung erreichen. „Als Konkurrenz zum Massengeschäft der GKV und PKV sehen wir uns ohnehin nicht“, betont er.
Quelle: Medical-Tribune-Recherche