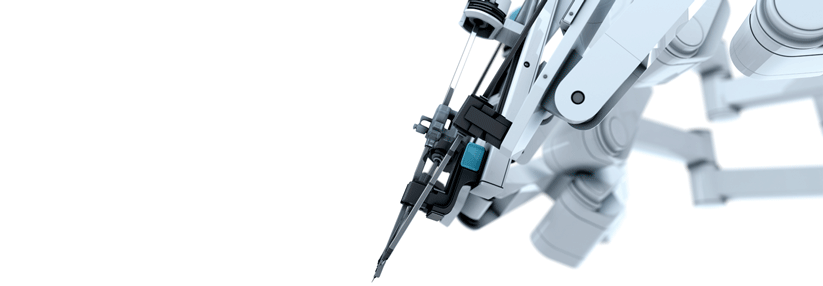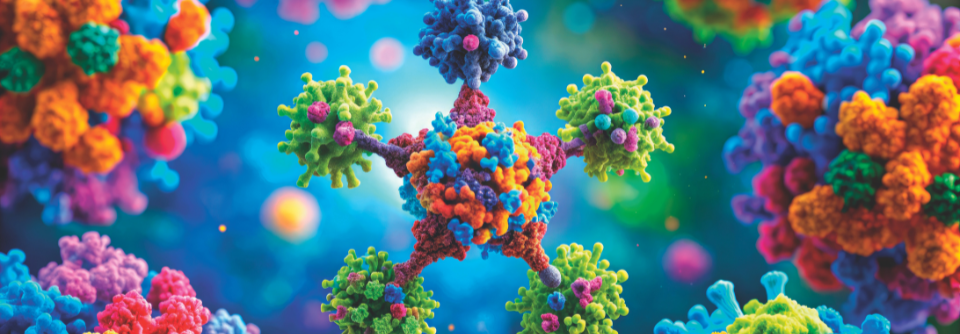Individualisierte Therapie Präzisionsonkologie auf ihrem Weg in die breite Versorgung
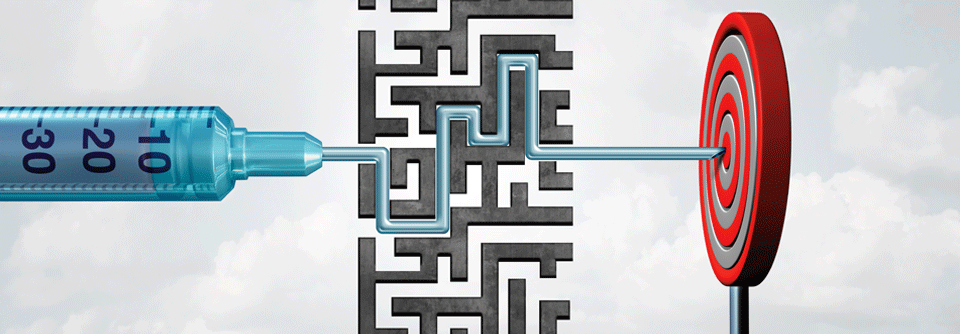 Personalisierte Therapien bringen Krebspatienten oft mehr Lebenszeit und mehr Lebensqualität.
© freshidea – stock.adobe.com
Personalisierte Therapien bringen Krebspatienten oft mehr Lebenszeit und mehr Lebensqualität.
© freshidea – stock.adobe.com
Präzisionsonkologie bzw. personalisierte Onkologie verfolgt das Ziel, jedem Krebspatienten anhand einer umfassenden molekularen, zellulären und funktionellen Analyse seines Tumors eine individualisierte Behandlung anzubieten“, heißt es beim Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg. Was aber bedeutet das praktisch in der Patientenversorgung? Dieser Fragestellung ging eine Gesprächsrunde nach, zu der der Kongressveranstalter WISO S.E. Consulting eingeladen hatte.
Professor Dr. Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO), bemerkte eingangs, er halte den Begriff der Präzisionsmedizin oder der personalisierten Medizin speziell auch in der Onkologie für weiter interpretationsbedürftig. Laut Wikipedia separiere personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin Personen in Gruppen als Voraussetzung für medizinische Entscheidungen. Das heiße jedoch nicht, dass eine gezielte Therapie für eine bestimmte Mutation die bessere sei. Man diskutiere aktuell darüber, was im Labor gemacht werden könne. „Aber dabei darf es nicht stehen bleiben. Onkologie muss breit definiert werden.“
Bei Therapiekonzepten geht es aus Sicht des Spezialisten nicht nur um bestimmte Medikamente, sondern auch um Therapiekonzepte für bestimmte Subgruppen, abhängig vom Rezidivrisiko. Auch das Thema Toxizität sei noch nicht abgearbeitet. „Ich denke, das Thema der nächsten Jahre wird sein: Therapiesteuerung bei den chronisch behandelten Patienten mit chronischen Verläufen.“
Dass es dafür umfangreiche Versorgungsdaten braucht, machte Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke, Vorsitzende des Deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung (DNVF), deutlich. Mit Real-World-Daten sehe man, was passiere, wo man etwas verbessern müsse und ob Patientinnen und Patienten die Therapie bekämen, die sie dringend bräuchten.
Die im Einzelfall anfallenden Datenmengen verdeutlicht die Wissenschaftlerin am Beispiel einer Frau mit Mammakarzinom, welche 2004 erkrankte und 2016 verstarb. Absolviert wurden viele Therapien – stationär, ambulant, in Tumorzentren, in Medizinischen Versorgungszentren und in vielen anderen Einrichtungen. Behandlungen erfolgten in drei Krankenhäusern und durch acht Praxen, im größeren Umkreis um zwei Wohnorte herum. 19 Onkologika wurden der Patientin verabreicht, auch war operiert worden wegen Leber- und Lungenmetastasen. „Wir haben gemerkt, dass wir unbedingt im Rahmen auch politischer Initiativen genau über diese Patienten Aussagen haben müssen“, so Dr. Klinkhammer-Schalke. Es sei auch wichtig hinsichtlich aktueller Leitlinien. Living Guidelines sei das Schlagwort im Moment. Diese müssten schnell umgesetzt werden, in Zentren bzw. in der Versorgung, und auch in der Versorgung vor Ort.
Künstliche App-Intelligenz kann bei Therapiewahl helfen
„Wir haben die Krebsregister jetzt in ganz Deutschland. Und wir haben seit letztem Jahr ein Gesetz zur Zusammenführung all dieser Daten, die per Meldepflicht für die Ärzte an die Register gemeldet werden müssen, aus allen Sektoren und im Detail“, zeigte sich die Rednerin zufrieden. Das DNVF hätte zur Erfassung versorgungsnaher Daten ein Manual erstellt mit allen Playern in der Onkologie und weiteren Partnern. Und ein sechsmonatiges Curriculum „Registerbasierte Forschung“ für Wissenschaftler:innen, Ärzt:innen und andere, die mit versorgungsnahen Daten arbeiten wollten, gehe nächstes Jahr in die Pilotumsetzung.
Probleme der onkologischen Versorgung in der klinischen Landschaft benannte PD Dr. med. Thomas Elter, Universität Köln. Leitlinien wären teils veraltet, denn „bis in die 90er-Jahre war die Onkologie langweilig“. Die einzige Strategie seitens der Chirurg:innen sei gewesen, wie viel man rausnehmen könne, und seitens der Internist:innen, wie viel Gift man gebe könne, damit ein Patient überlebt. Heute endlich tue sich etwas, so Dr. Elter – aber so dramatisch, dass der einzelne Arzt es nicht mehr überschauen könne. Die Lösung sollte die Zertifizierung sein, sagte Dr. Elter, aber für diese müssten alle Betroffenen einem Tumorboard vorgestellt werden, wodurch diese Boards überlastet wären. Aus 10 bis 12 Patienten pro Woche seien 40 bis 50 die Stunde geworden.
Wie bekommt man Präzisionsonkologie trotzdem in die Fläche? Möglich sei es über Künstliche Intelligenz (KI), meinte Dr. Elter, zugleich Geschäftsführer der Onqo Health GmbH. Er berichtete über die App EasyOncology, eine Schnittstelle für etablierte Tumorboard-Software. „In dem Moment, wo der Arzt seinen Patienten zur Klinikkonferenz anmeldet, schlagen die Algorithmen eine Therapieempfehlung vor.“ Das sei dann der Standardfall. Dafür müssten aber eben Daten der Patient:innen vorformatiert verfügbar sein und deshalb brauche man die Ärztinnen und Ärzte, die die Erkrankten anmelden und dem System ermöglichen, anhand einfacher Therapiealgorithmen zu definieren, was gemacht werden muss. Ein solches Versorgungmanagement führe zu mehr Sicherheit für Patient:innen, Ärzt:innen und Kliniken. Es sei schnell und preiswert umzusetzen in der Fläche. Es sei ein Werkzeug für alle, wo aber auch viele mitmachen müssten: „Wir sehen das als ,Open Specialist Platform‘ erfahrener Zentren.“ Es wäre für jede Entität und Therapielinie geeignet.
Dr. Ursula Marschall, Ärztin und Bereichsleiterin im Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung, sieht viele Optionen, die aber zum heutigen Zeitpunkt oft nicht wirklich genutzt werden. So fehlten Netzwerke, nicht nur zwischen Kliniken und zwischen molekularen Tumorboards, auch zwischen niedergelassenen Kolleg:innen. Es gebe schließlich viele hochspezialisierte ambulante Praxen mit sehr hohem Wissen. „Und wir reden viel, häufig jedoch über die Patienten – selten mit den Patienten.“
Prof. Dr. Helmut Ostermann, Vorsitzender des DGHO-Arbeitskreises DRG und Gesundheitsökonomie, sieht Deutschland hinsichtlich onkologischer Medikamente gut aufgestellt, „weil man diese im Prinzip nach der Zulassung im ambulanten Bereich verfügbar hat und geben kann“. Und im stationären Bereich gebe es ein sehr erfolgreiches Werkzeug mit dem Verfahren zu neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB). In diesem Jahr seien 137 Medikamente im NUB-Verfahren, 2011 seien es 29 gewesen.
„Was mich seit vielen Jahren umtreibt, ist, dass wir bei der Diagnostik noch Defizite haben in Deutschland“, so Prof. Ostermann. Auch beim Lungenkarzinom sollte es doch möglich sein, die Diagnostik dort zu machen, wo die Probe anfalle, statt Reibungsverluste in andere Sektoren hinein zu haben und am Ende nicht alle Patient:innen „molekular vernünftig diagnostiziert zu bekommen“. Den Terminus Präzisionmedizin sieht Ostermann übrigens kritisch, weil er bei Patient:innen den Eindruck erwecken könne, „wer was präzise macht, macht es richtig, und wer etwas nicht präzise macht, macht es unpräzise und damit nicht gut“.
Man brauche die ePA zur Datenvernetzung
Der Kemptener Hausarzt Dr. Dominik Spitzer sieht das deutsche Gesundheitswesen in IT-Dingen in den Kinderschuhen stecken: „Wenn wir tatsächlich vorwärtskommen wollen, was Künstliche Intelligenz, Datenerfassung und Register anbelangt, brauchen wir die Vernetzung, und zwar mittels einer elektronischen Patientenakte.“ Den Hausärzt:innen, die umsetzen, was vom spezialisierten Bereich empfohlen wird, fehle die Zeit, sich mit ihren Patientinnen und Patienten hinzusetzen und alles in Ruhe durchzusprechen. Für Dr. Spitzer stellt sich deshalb die Frage, ob Versorgungsdaten nur für Statistikzwecke erhoben werden oder tatsächlich auch für mehr Lebensqualität und Lebenszeit der Patient:innen.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
WiZen – ein Beispiel für die Auswertung von Versorgungsdaten
Das sächsische Innovationsfondsprojekt „WiZen“ ging der Frage nach, ob die Versorgung in onkologischen Zentren besondere Auswirkungen hat. Betrachtet wurde anhand von AOK-Abrechnungsdaten sowie Daten von vier klinischen Krebsregistern (KKR) die Versorgung von Patienten mit Brustkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Dickdarmkrebs sowie Tumoren des Zentralnervensystems, des Kopf-Hals-Bereiches und gynäkologische Tumoren. Im April lag der Abschlussbericht vor. Fazit: Es gibt deutliche Überlebensvorteile für Krebspatienten bei Behandlung in zertifizierten Zentren. Für neun von elf betrachteten Entitäten zeigten sich signifikante Ergebnisse für die 30-Tages-Mortalität sowie die 2-, 3-, 4- und 5-Jahres-Überlebensraten. Kürzlich veröffentlichte auch der Innovationsausschuss eine positive Bewertung mit dem Hinweis, dass der Unterausschuss Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses die Erkenntnisse aus dem Projekt zeitnah prüfen und deren Berücksichtigung bei der Festlegung von Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität ausloten soll. Und das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) soll prüfen, ob die Erkenntnisse des Projekts bei der Erstellung von Kriterien zur Bewertung von Zertifikaten und Qualitätssiegeln genutzt werden können.