
Recht auf Sterben vs. Recht auf Leben: Ärztekammer will bei ethischen Grenzfällen assistieren
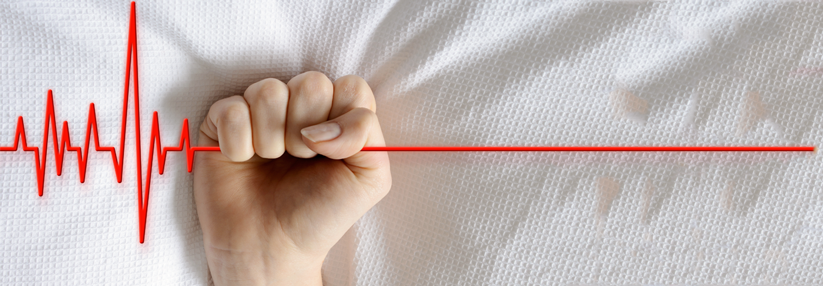 Recht auf Leben oder Recht auf Sterben? Bei solchen Fragen kann eine Ethik-Kommission helfen.
© Dan Race – stock.adobe.com
Recht auf Leben oder Recht auf Sterben? Bei solchen Fragen kann eine Ethik-Kommission helfen.
© Dan Race – stock.adobe.com
Das Verfassungsgericht habe auch klargestellt, dass künftige Regelungen zur Sterbehilfe nicht zu einer zur Aushöhlung des Rechts auf Selbsttötung führen dürften, betont Henke. Diese Autonomie habe das Gericht jedermann gewährt, nicht nur denen, die durch eine Krankheit gequält würden. Der Kammerchef erwartet eine geänderte gesellschaftliche Debatte in Deutschland. Dabei verpflichte auch das Karlsruher Urteil Ärzte nicht zur Beihilfe zum Suizid. Die Ärztekammer in Düsseldorf wolle den Ärzten „bei Entscheidungen in ethischen Grenzfällen assistieren“.
Diese Grenzfälle gehörten zum Alltag vor allem der Palliativmediziner, berichtete Barbara Kertz, Ärztin für Allgemein- und Palliativmedizin aus Köln. Laut einer Umfrage unter 900 Palliativmedizinern tragen 10 bis 30 % der Patienten den Wunsch nach Suizidassistenz an ihre Ärzte heran. 3 % der befragten Kollegen hätten diese Hilfe auch gewährt, ein Arzt sogar zwölfmal.
Reise zu Dignitas in die Schweiz nicht angetreten
„Doch der Wunsch nach Sterbehilfe ist häufig nicht gleichzusetzen mit der Aufforderung nach Suizidbeihilfe oder aktiver Sterbehilfe“, betont Kertz. Nach ihrer Erfahrung wird dieser Wunsch häufig von Patienten mit einem hohen Autonomiebedürfnis geäußert. Dahinter verberge sich das Verlangen nach einem offenen Austausch mit dem Arzt, auch über alternative Therapieentscheidungen.
So auch im Fall der 61 Jahre alten Patientin mit einem metastasierenden Ovarialkarzinom. Sie war seit Jahren Mitglied bei Dignitas und stellte klar, dass sie in die Schweiz fahren wolle zum assistierten Suizid. Nach ausführlichen Gesprächen über ein palliatives Behandlungskonzept und einer weiteren Verschlechterung ihres Zustands stimmte die Patientin der Aufnahme in ein Hospiz zu, wo sie einige Wochen nach der Aufnahme verstarb. „Über die Reise in die Schweiz hat sie nicht mehr gesprochen“, so Kertz.
Patienten dokumentieren ihre Autonomie häufig in Patientenverfügungen. „Das ist nicht nur ein Instrument für hochbetagte Menschen“, betont Professor Dr. Dominik Groß, Vorsitzender des Ethik-Komitees der Uniklinik Aachen und Leiter des Lehrstuhls Ethik der Medizin an der RWTH Aachen. Er fordert insbesondere die Hausärzte auf, ihre Patienten beim Abfassen einer solchen Verfügung zu unterstützen. Denn die Festlegungen sollten möglichst konkret sein. Wenig hilfreich seien Formulierungen wie „der generelle Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen“ oder „unerträgliches Leiden“ oder „hoffnungsloser Zustand“. Aber „eine schwammige Verfügung ist besser als keine“, meint Prof. Groß.
„Liegt eine solche Verfügung vor, so müssen sich alle daran halten, nicht nur die behandelnden Ärzte, sondern auch das gesamte in Notfallsituationen involvierte Personal“, betont Dr. Stefan Meier, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik Düsseldorf. Das gelte auch für das Personal von Pflegeheimen. Aber in der Praxis klagten seine Kollegen darüber, dass sie „selten bis nie“ genug Zeit hätten, um nach einer Patientenverfügung zu fragen und diese zu lesen, auszulegen, anzuwenden.
Verfügung und Vollmacht
Quelle: Prof. Dr. Dominik Groß
„Zufuhr von viel Flüssigkeit führt nur zu viel Leid“
Ein Gewichtsverlust sei daher nicht zu verhindern. Auch die Flüssigkeitsnormen für Gesunde hätten hier keine Gültigkeit. Im Gegenteil. „Die Zufuhr von viel Flüssigkeit führt nur zu viel Leid, bis hin zum Lungenödem“, so Vonderhagen. 500 ml in 24 Stunden hätten sich als völlig ausreichend erwiesen. Auch demente Patienten würden von einer PEG-Anlage nicht profitieren. Häufig würden sie bei Bestehen einer PEG auch noch fixiert. Bei Wachkomapatienten sei diese Methode ebenfalls kritisch zu hinterfragen. „Die PEG-Sonde ist keine Basisversorgung“, so Dr. Vonderhagen. Nicht nur am Lebensende, auch am Lebensanfang stellen sich schwierige ethische Fragen. Neu- oder Frühgeborene sind zu eigenen Willensbekundungen nicht fähig. „Doch sie haben die vollen Grund- und Menschenrechte“, betont Dr. Angela Kribs, Oberärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Köln. Konkret stelle sich immer wieder die Frage: „Sollen wir das minimal Notwendige tun oder sollen wir mit einer invasiven Therapie beginnen?“ Damit die Eltern im Sinne ihres Kindes entscheiden könnten, seien sie wahrheitsgemäß aufzuklären, nicht nur über Risiken und Chancen einer Therapie, sondern auch über Schmerzen, die eine Therapie verursachen könne. Wenn zum Beispiel das Leben nur durch eine Bauchfelldialyse aufrechterhalten werden könne – mit Folgen für das ganze zukünftige Leben. Dr. Kirbs: „Wir müssen abwägen zwischen dem Recht auf Leben und dem Recht auf Sterben und körperliche Unversehrtheit.“ Leitschnur ist das Prinzip der verantwortungsvollen Einzelfallentscheidung. Rund drei Viertel der Kliniken sollen eigene Ethik-Kommissionen eingerichtet haben, berichtet Dr. phil. Arnd May, Medizinethiker vom Zentrum für Angewandte Ethik in Erfurt. Hessen schreibe als einziges Bundesland in seinem Krankenhausgesetz diese Gremien vor. Im niedergelassenen Bereich stehe nichts Vergleichbares zur Verfügung. Der 111. Deutsche Ärztetag hatte dazu aufgerufen, solche Komitees zu gründen. Das große Interesse der niedergelassenen Kollegen am ersten Ethik-Symposium des Ethik-Komitees bestätigt die Initiative der Ärzekammer Nordrhein.Quelle: Veranstaltung der Ärztekammer Nordrhein





