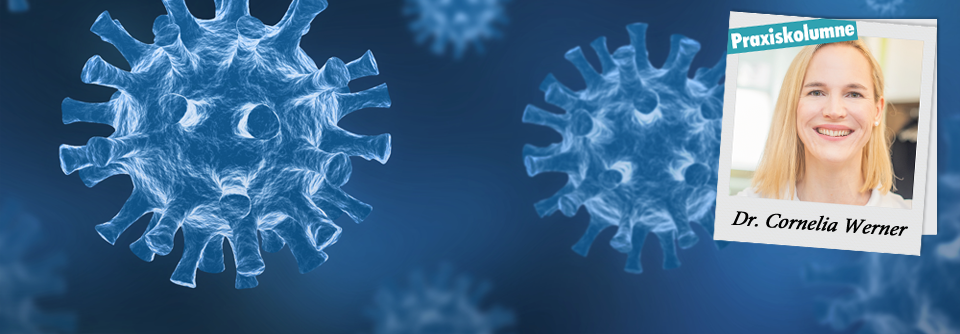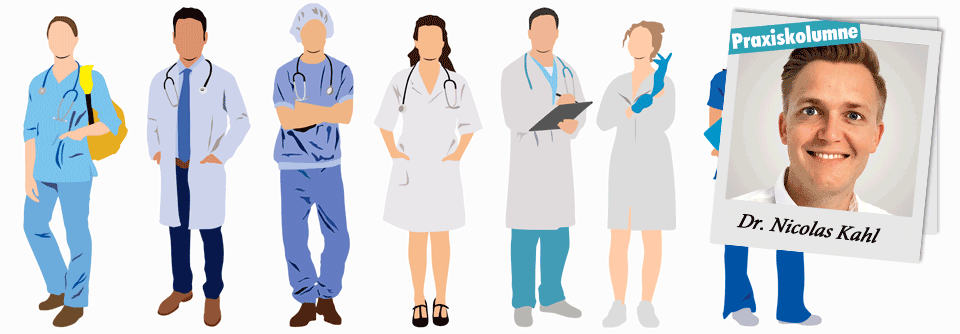Praxiskolumne SOS im Bereitschaftsdienst
 "Denn wie meine eigene Erfahrung zeigt, kann man dort nur auf rudimentärem Niveau arbeiten."
© M.Dörr & M.Frommherz - stock.adobe.com
"Denn wie meine eigene Erfahrung zeigt, kann man dort nur auf rudimentärem Niveau arbeiten."
© M.Dörr & M.Frommherz - stock.adobe.com
In einer Situation, in der die ärztliche Versorgung eh schon mehr schlecht als recht gesichert ist, hätte man sich eine andere Rechtsprechung des Bundessozialgerichts oder zumindest eine Übergangslösung gewünscht. Aber wir wären nicht in „good old Germany“, wenn man es dem Gesundheitssystem leicht machen würde. Bei uns in der Region ist damit nun einer von drei Fahrdiensten gestrichen und viele Sitzdienste sind zur Übernahme frei geworden.
Fan von Fahrdiensten bin ich nicht mehr, spätestens nach einigen sehr gruseligen, gefährlichen Einsätzen, in die man sonst keine Person (erst recht keine weibliche) einfach so schicken würde. Die Sitzdienste, sollte man meinen, sind doch schnell zu leisten und nicht so tragisch. Finden sich nun Übernehmer? Sieht nicht so aus. Ich melde mich zumindest nicht freiwillig, solange der Sitzdienst in den Räumen und mit den „Möglichkeiten“ der KV-Notdienstpraxis geschehen muss. Denn wie meine eigene Erfahrung zeigt, kann man dort nur auf rudimentärem Niveau arbeiten.
Sitzdienst erfolgt unter widrigen Bedingungen
Die KV-eigene MFA, die mich empfing, eröffnete mir sogleich, dass sie lediglich die Daten der Patienten aufnehme und mir dann reinreiche. Die Notdienstpraxis besteht aus einem sehr kleinen Raum innerhalb eines Krankenhauses. Das Mobiliar wird teilweise mit Mullbinden zusammengehalten. Die „Technik“ kommt eher aus den 1990ern. Im PC ein Praxisverwaltungssystem der KV, komplett unlogisch strukturiert. Die einzelnen Formulare darf ich noch händisch in einen Nadeldrucker legen. Das macht richtig Freude, dieses ursprüngliche Gefühl und der Spaß, wenn das Formular verrutscht, oder gar das falsche eingelegt war.
Zwischen den Patientenkontakten mal eben ein Fenster öffnen, um den Raum zu lüften? Unmöglich, aber ist ja auch nur Infektsaison. Nebenan darf ich einen weiteren halben Raum benutzen. Dieser wird durch eine magische Grenze geteilt. Auf die Krankenhausseite soll ich nicht, auch nichts von dort benutzen. Ich muss mich schön links halten. Dort steht zumindest eine Liege und man hat die Möglichkeit, eine Infusion zu geben. Ich bin begeistert.
Für einen Patienten mit Bronchitis hätte ich gerne einen CRP-Schnelltest. Gibt es nicht. Entweder ich nehme ihm ein komplettes Labor ab, dessen Ergebnis ich in einer Stunde bekomme, oder ich verzichte darauf. Ich verzichte. Also doch eher das Rezept mit dem Antibiotikum. Denn der Patient will definitiv nicht noch länger draußen auf dem Gang sitzen. Innerlich fluche ich.
Die nächste Patientin hat Glück: Ich kann zumindest einen Urin-Stix machen. Nur wenn ich jetzt auch noch eine Pyelonephritis oder einen Aufstau ausschließen möchte … Nein, ein Sonogerät steht mir nicht zur Verfügung. Das im Nachbarraum gehört dem Krankenhaus. Und wenn ich eine Sono brauche, muss ich die Patientin in die Notaufnahme rüberschicken und sie muss dort das ganze Prozedere von vorne durchlaufen. Prima.
Ich sitze im unbelüftbaren „Ebola“-Zimmer mit einem U-Stix und einem Nadeldrucker
Ich sitze an meinem mir zugewiesenen Platz, kämpfe die meiste Zeit mit den fehlenden Strukturen und der Bürokratie, verdrehe die Augen nach oben und entdecke über der Liege einen Karton mit der Aufschrift „Ebola“. Für Ebola wäre ich hier also gerüstet? Interessant.
Während ich also „arbeite“, versuche, meinem hohen Standard gerecht zu werden und daher etwas verzweifle, denke ich an meine Praxis. Sie entspricht den hygienischen, digitalen und allen anderen Ansprüchen, die die KV, das Gesundheitsamt und sonstige Behörden inzwischen von uns fordern. Aber ich sitze hier im unbelüftbaren „Ebola“-Zimmer mit einem Urin-Stix und einem Nadeldrucker.
Ich bin mehr als erleichtert, als meine Zeit dort vorbei ist. Und mehr als entsetzt darüber, wie wenig Geld ich für meine Leistungen dort erhalte – abzüglich der Notdienstpauschalen, die die KV ja sowieso von jedem Kassenarzt abzieht. Ich zumindest wäre bereit, mehr Sitzdienste zu machen. Aber nicht unter widrigen Bedingungen, sondern mit dem Standard, in dem Medizin im Jahre 2023 möglich sein sollte.