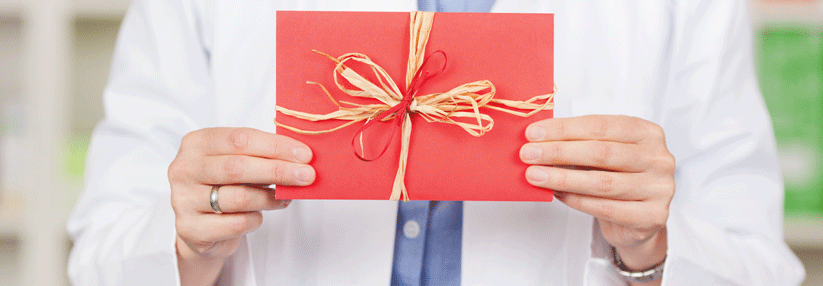
Regierungsankündigungen Wir stärken, wir schaffen, wir wollen, wir prüfen
 Auch wenn Koalitionsvereinbarungen nichts sind, auf das man die Protagonisten in instabilen Zeiten festnageln sollte: Fürs Gesundheitswesen sind die Erwartungen an Union und SPD hoch.
© atipong - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Auch wenn Koalitionsvereinbarungen nichts sind, auf das man die Protagonisten in instabilen Zeiten festnageln sollte: Fürs Gesundheitswesen sind die Erwartungen an Union und SPD hoch.
© atipong - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, gab mit Bekanntwerden des Koalitionsvertrags dem „heute“-Publikum ein paar Interpretationshinweise zur Verbindlichkeit der Ankündigungen mit. Die lauteten sinngemäß etwa so:
- „Werden“ heißt: Das packen wir an. „Stärken“ und „fördern“ geht immer.
- „Wollen“ heißt: Wir haben die feste Absicht, wir versuchen es.
- „Sollen“ heißt: Wäre schön, wenn es klappt.
- „Prüfen“ heißt: Kommt Zeit, kommt Rat.
- „Ziel ist es“ heißt: Wunschkonzert.
Allerdings steht die gesamte schwarz-rote Ideensammlung unter Finanzierungsvorbehalt, wie der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont. Fehlt das Geld im Haushalt, muss neu überlegt werden. Beim Punkt Einkommensteuererleichterungen wurde schon klar: „Werden“ heißt hier „wollen“.
Oha! Denn Union und SPD schreiben zu GKV und sozialer Pflegeversicherung (SPV): „Ziel ist es, die Finanzsituation zu stabilisieren und eine weitere Belastung für die Beitragszahlerinnen und -zahler zu vermeiden.“ Und: „Wir wollen die Einnahmen durch ein höheres Beschäftigungsniveau vergrößern und die Kosten auf der Ausgabenseite reduzieren.“ Für konkrete Maßnahmen bildet man erstmal einen Arbeitskreis, sprich eine Kommission inklusive Expertinnen und Experten sowie Sozialpartnern. Vorschläge sind im Frühjahr 2027 willkommen.
Krankenkassen warten auf weitere Steuermilliarden
Bei den Krankenkassen ist man ernüchtert. „Positiv ist allein die Zusage, den GKV-Anteil für den geplanten Krankenhaustransformationsfonds aus dem Sondervermögen Infrastruktur zu finanzieren“, erklärt Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen (vdek). Die Kassen hatten eine Verfassungsklage zur Zweckentfremdung von GKV-Mitteln für die Investitionsfinanzierung angekündigt.
Die Übernahme der Krankenversicherungskosten der Bürgergeldempfangende und die Rückzahlung coronabedingter Aufwendungen an die SPV haben es nicht ins Koalitionspapier geschafft.
| IGES-Projektion Beitragssätze in der Sozialversicherung | |||
|---|---|---|---|
| Gesetzlicher Versicherungszweig | 2025 | 2029 | 2035 |
| Krankenversicherung | 17,5 % | 18,5 % | 20 % |
| Pflegeversicherung | 3,8 % | 4,4 % | 4,5 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 20,0 % | 21,2 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 2,7 % | 3,1 % |
| Sozialversicherung gesamt | 42,5 % | 45,7 % | 48,8 % |
| Quelle: IGES, Berechnung im Auftrag der DAK-Gesundheit | |||
| Ein Szenario, wie sich die Beitragssätze entwickeln könnten, wenn der Politik nichts zur Beeinflussung von Einnahmen und Ausgaben einfällt. | |||
Punkte im Koalitionsvertrag
ie Regierungsvereinbarung von CDU, CSU und SPD streift viele Aspekte der Gesundheitsversorgung. Hier eine Auswahl:
- Bereitschaftsdienst: Gesetzliche Regelung, „die die Sozialversicherungsfreiheit von Ärztinnen und Ärzten im Bereitschaftsdienst der Krankenversicherung ermöglicht“.
- Investorenbetriebene MVZ: iMVZ-Regulierungsgesetz stellt Transparenz über die Eigentümerstruktur her sowie „die systemgerechte Verwendung der Beitragsmittel“ sicher.
- Cannabis: „Ergebnisoffene Evaluierung“ der Legalisierung im Herbst 2025.
- Strafrecht: Verschärfung des strafrechtlichen Schutzes von Einsatz- und Rettungskräften, Polizistinnen und Polizisten sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe.
- Mutterschutz für Selbstständige: „Analog zu den Mutterschutzfristen für Beschäftigte.“
- Verhütungsmittel: Kostenlose Abgabe von ärztlich verordneten Verhütungsmitteln für Frauen bis zum 24. Lebensjahr wird geprüft.
- Organspende: „Aufklärung und Bereitschaft sollen gefördert werden.“
Dabei könnte die neue Bundesregierung mit den rund 15 Mrd. Euro ad hoc einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Beitragssätze leisten, erklärt Prof. Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer.
Dr. Carola Reimann, Vorstandschefin des AOK-Bundesverbandes, moniert, dass die neue Koalition das Problem der „ungebremst steigenden Arzneimittelpreise komplett ausspart“. Bei den Apotheken würden „die Ausgabenschleusen sogar noch weiter geöffnet“. Sie kritisiert auch die geplante Einführung einer Bagatellgrenze von 300 Euro bei Regressen und die Absenkung der Prüfquote bei Krankenhäusern.
Es mangelt nicht an Ideen für ein Primärarztsystem
Schwarz-Rot verspricht den Apotheken das Ende des „Skonti-Verbots“ sowie die Anhebung des Packungsfixums von 8,35 auf 9,50 Euro bzw. auf bis zu 11 Euro für ländliche Apotheken. Der Großhandelsverband Phargo wettert allerdings gegen „nach oben unbegrenzte Preisnachlässe“ und eine Erlös-Umverteilung zugunsten der Apotheken.
Bezüglich des AMNOG ist im Koalitionsvertrag nebulös von einer Weiterentwicklung bei den „Leitplanken“ und bei der personalisierten Medizin die Rede. „Dabei ermöglichen wir den Zugang zu innovativen Therapien und Arzneien und stellen gleichzeitig eine nachhaltig tragbare Finanzierung sicher.“
Positiv sehen die Chefinnen des AOK- sowie des Ersatzkassenverbandes die Ankündigung der überfälligen Notfall- und Rettungsdienstreform sowie eines verbindlichen Primärarztsystems. Der vdek bringt wieder sein Konzept ins Spiel: Versicherte wählen verbindlich für ein Jahr ein persönliches Ärzteteam– eine Hausärztin / einen Hausarzt
Was die KV vorschlägt
Die KV Westfalen-Lippe hat in einem Positionspapier Bausteine für eine „zukunftsgerechte Versorgung“ zusammengetragen. Dazu gehören u. a.:
- Patientensteuerung: In einem verbindlichen „Bezugspraxensystem“ fungieren Hausarzt-, Kinder- und Jugendarzt- sowie grundversorgende Facharztpraxen als primäre Ansprechpartner und Überweiser. Dafür gibt es eine Koordinierungspauschale.
- Vergütung: Entbudgetierung auch im fachärztlichen Bereich (erster Schritt: vollständige Vergütung der Überweisungsfälle von Bezugspraxen). Ablösung des persönlichen Arzt-Patienten-Kontaktes durch den Praxis-Patienten-Kontakt. Jährlich voller Ausgleich von Kostensteigerungen. Ausweitung des Hybrid-DRG-Leistungskatalogs.
- Teampraxis: Finanzielle Unterstützung für Teampraxen und die Integration neuer Berufsgruppen wie Physician Assistants. Mehr Delegationsmöglichkeiten an qualifiziertes Personal. Gesetzliche Regelungen zur Aufgabenverteilung zwischen Ärztinnen/Ärzten und nicht-ärztlichem Personal.
- Praxiszukunftsgesetz: Investitionsförderprogramm für IT-Sicherheit, den Wechsel von IT-Systemen und die Implementierung neuer Prozesse in den Praxen. Förderung digitaler Kompetenz im Praxisteam (z. B. Ausbildung von Digi-Managerinnen).
und bis zu drei grundversorgende Fachärztinnen/-ärzte – aus, die sie ohne Überweisung in Anspruch nehmen können. Daneben lässt sich eine telemedizinische Ersteinschätzung per Telefon oder App nutzen, die zu einer Versorgungsempfehlung führt und der sich ggf. eine Videosprechstunde anschließt. Auch von KV-Seite gibt es Gestaltungsvorschläge (siehe Kasten oben).
Im Koalitionsvertrag heißt es: Zur zielgerichteten Patientenversorgung und für eine schnellere Terminvergabe „setzen wir auf ein verbindliches Primärarztsystem bei freier Arztwahl durch Haus- und Kinderärzte in der Hausarztzentrierten Versorgung und im Kollektivvertrag“. Ausgenommen werden Augenheilkunde und Gynäkologie. Für Patientinnen und Patienten mit einer spezifischen schweren chronischen Erkrankung werden „geeignete Lösungen“ erarbeitet, z. B. Jahresüberweisungen oder der „Fachinternist als steuernder Primärarzt im Einzelfall“.
Die Primärärztinnen/-ärzte oder die KV-Terminservicestelle (116 117) „stellen den medizinisch notwendigen Bedarf für einen Facharzttermin fest und legen den dafür notwendigen Zeitkorridor (Termingarantie) fest“. Die KV muss diese Termine vermitteln. Eine digitale Möglichkeit der strukturierten Ersteinschätzung samt Telemedizin ist geplant.
Für den Hausärztinnen- und Hausärzteverband ist klar: „Wer zeitnah ein gutes und wissenschaftlich evaluiertes Primärarztsystem umsetzen will, der muss auf die HzV bauen.“ Das KV-System sei nicht in der Lage, notwendige Reformen umzusetzen, und habe „bis heute keinen konzertierten und schlüssigen Vorschlag für ein funktionierendes Primärarztsystem vorgelegt“.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht



