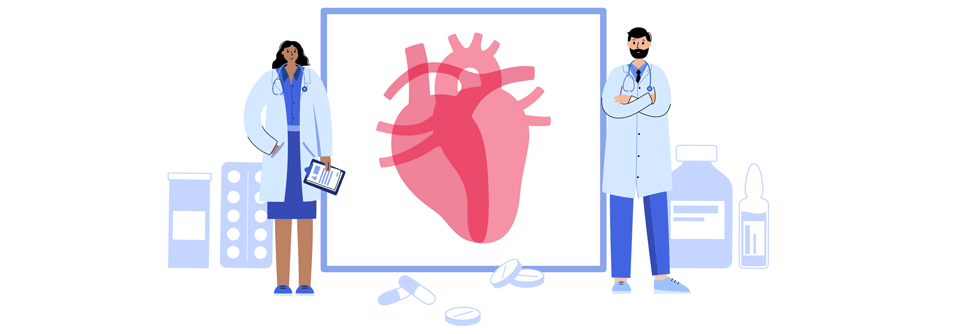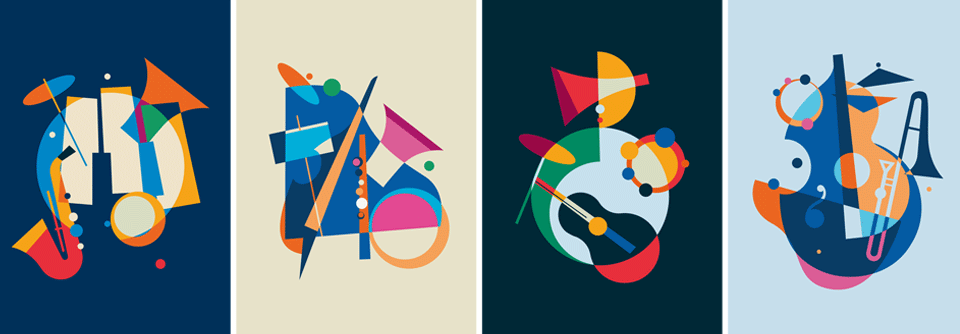Auf neuronalen Wegen
 Eine Post-hoc-Analyse belegte die Steigerung der Insulinsensitivität ausschließlich für die Testpersonen, die Verumgaben erhalten hatten.
© eyetronic – stock.adobe.com; Victor Moussa – stock.adobe.com
Eine Post-hoc-Analyse belegte die Steigerung der Insulinsensitivität ausschließlich für die Testpersonen, die Verumgaben erhalten hatten.
© eyetronic – stock.adobe.com; Victor Moussa – stock.adobe.com
Übergewicht und Typ-2-Diabetes sind häufig mit einer Insulinresistenz im Gehirn assoziiert, die wiederum die Regulation des peripheren Metabolismus beeinträchtigt. Bisher gibt es dafür keine pharmakologische Behandlung. Könnte Empagliflozin ein geeigneter Kandidat sein? Diese Frage untersuchte ein Team um Prof. Dr. Martin Heni und PD Dr. Stephanie Kullmann vom Institut für Diabetesforschung und metabolische Erkrankungen des Helmholtz Zentrums München an der Universität Tübingen, einem Partner des DZD.
An der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-2-Studie nahmen 40 Personen mit Prädiabetes teil. Voraussetzung waren eine gestörte Glukosetoleranz bzw. ein gestörter Nüchternblutzucker sowie Übergewicht (durchschnittlicher BMI: 31,5 ± 3,8 kg/m²). Von den Teilnehmenden erhielten 21 Placebo und 19 Empagliflozin (25 mg/d). Das Durchschnittsalter lag bei 60 ± 9 Jahren. Die Insulinsensitivität im Gehirn bestimmten die Forschenden durch funktionelle MRT-Bildgebung in Kombination mit intranasal verabreichtem Insulin. Das Insulin-Nasenspray ermöglicht eine selektive Stimulation der Hirnaktivität, wobei nur marginale Mengen des Hormons ins Blut gelangen.
Hirnsensitivität für Insulin vermittelt wohl Leberfettsenkung
Zu Studienbeginn war – wie erwartet – kein Insulineffekt auf den Hypothalamus messbar. Diese Resistenz sank in der Prüfgruppe: Nach acht Wochen unter Empagliflozin registrierten die Wissenschaftler*innen eine Zeit-/Behandlungs-Interaktion im Hypothalamus. Diese war auch nach Adjustierung für BMI allein bzw. für BMI, Geschlecht und Alter signifikant. Eine Post-hoc-Analyse belegte die Steigerung der Insulinsensitivität ausschließlich für die Testpersonen, die Verumgaben erhalten hatten. Auch sank das per Fragebogen ermittelte Hungergefühl im nüchternen Zustand unter dem SGLT2-Hemmer. Auf die periphere Insulinsensitivität nahm das Medikament keinen Einfluss, auch nicht auf das Körpergewicht.
Mittels Mediationsanalysen (siehe Kasten) untersuchten Prof. Heni und sein Team, ob die hypothalamische Insulinsensitivität als Vermittler zwischen Empagliflozin und mehreren abhängigen Variablen fungiert. Es ergab sich ein signifikanter, negativer, indirekter Effekt durch die Behandlung: Bei unveränderter Kalorienzufuhr waren sowohl der Leberfettanteil als auch der Nüchternblutzucker geringer als zu Studienbeginn.
Mediationsanalyse
Quelle: Kullmann S et al. Diabetes Care 2021; DOI: 10.2337/dc21-1136
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).