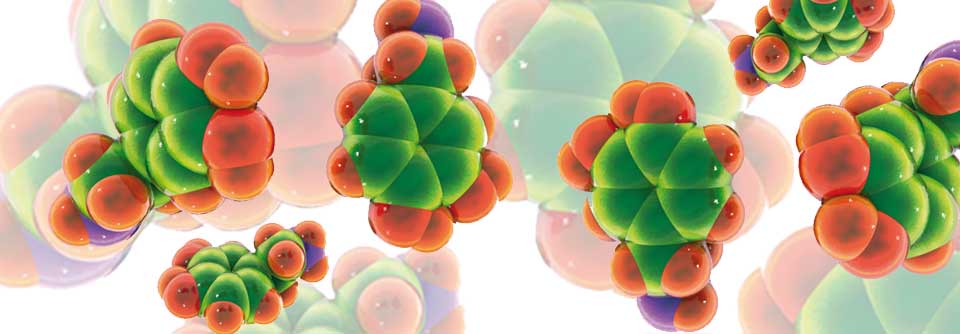Bis zu vier Stunden weniger im OFF
 41 % der Parkinsonpatienten zeigen nicht-motorische Fluktuationen.
© napat – stock.adobe.com
41 % der Parkinsonpatienten zeigen nicht-motorische Fluktuationen.
© napat – stock.adobe.com
Parkinonsonpatienten entwickeln rund vier bis sieben Jahre nach dem Beginn einer kontinuierlichen dopaminergen Stimulation die ersten, meist noch kurzen OFF-Phasen. Diese werden mit der Zeit immer länger, zudem entwickeln sich ON-Dyskinesien. Insgesamt verengt sich dadurch das therapeutische Fenster immer weiter, erklärte PD Dr. Monika Pötter-Nerger von der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit den motorischen Einschränkungen flukturieren im OFF auch die nicht-motorischen Symptome, etwa Apathie, Depression, Ängste, Schmerzen und kognitive Einschränkungen. Manische Phasen, Schmerz und Unruhe treten dagegen in ON-Phasen mit Dyskinesien auf. In einer großen Kohorte zeigte sich, dass 41 % der Parkinsonpatienten nicht-motorische Fluktuationen zeigen, am häufigsten Fatigue (69 %) und Angst (62 %). Wann lohnt es sich, eine Pumpentherapie zu starten, um die Symptome und auch die Lebensqualität der Patienten zu verbessern? Um dies zu beruteilen, kann man Dr. Pötter-Nerger zufolge das „5-2-1-Kriterium“ zurate ziehen. Danach ist derjenige ein Kandidat für die gerätegestützte Therapie, bei dem pro Tag eine oder mehrere dieser Beschwerden zutreffen:
- mindestens 5 orale L-Dopa-Dosen
- OFF-Phasen von mindestens 2 Stunden Dauer
- behindernde Dyskinesien über mindestens 1 Stunde
Auch mithilfe des Online-Tools „Manage-PD“ kann man nach Aussage der Kollegin die Indikation zur Pumpentherapie stellen. Damit werden anhand von zehn Domänen geeignete Patienten identifiziert und kategorisiert.
Ein höheres Lebensalter (≥ 65 Jahre) oder eine längere Krankheitsdauer (≥ 10 Jahre) sind laut den Ergebnisse einer Post-hoc-Analyse des Registers GLORIA allerdings kein Prädiktor dafür, dass eine Pumpentherapie die Lebensqualität der Patienten verbessert. Aussagekräftig war nur eine OFF-Zeit von mehr als drei Stunden pro Tag vor Beginn der gerätegestützten Behandlung.
Ab Herbst stehen vier Wirkstoffe zur Verfügung
Ist die Entscheidung für eine Medikamentenpumpe gefallen, stellt sich die Frage nach dem zu verwendenden Wirkstoff. In Betracht kommen Pumpentherapien mit
- Apomorphin,
- LCIG (Levodopa-Carbidopa-Intestinalgel),
- LECIG (Levodopa-Entacapon-Carbidopa-Intestinalgel) oder
- subkutanem L-Dopa (voraussichtlich ab Herbst).
In einem Review von acht Studien konnte gezeigt werden, dass die Apomorphintherapie sowohl Placebo als auch oralem L-Dopa im Hinblick auf die OFF-Zeit-Reduktion überlegen ist. Gegenüber LCIG erwies sie sich als gleichwertig, der tiefen Hirnstimulation jedoch als unterlegen. Ähnliches galt in puncto Dyskinesien.
In der Toledo-Studie über zwölf Wochen mit 106 Patienten verminderte sich unter Apomorphin die OFF-Zeit um 2,47 Stunden, die ON-Zeit nahm um 2,77 Stunden zu. In der Verlängerungsstudie mit offenem Follow-up über 52–64 Wochen, aber nur noch 59 Patienten, waren die positiven Effekte auf ON- und OFF-Zeiten weiterhin nachweisbar (-3,66 h bzw. +3,31 h). Durch seinen Effekt auch auf nicht-motorische Symptome wie Schlaf, Apathie und Aufmerksamkeit könne Apomorphin in bestimmten Fällen von Vorteil sein, erklärte Dr. Pötter-Nerger.
Für die intrajejunale Levodopa-Applikation via LCIG-Pumpe gibt es mittlerweile Daten über fünf Jahre. Auch nach dieser Zeit wird die OFF-Zeit um etwa vier Stunden täglich verkürzt bzw. die ON-Zeit ohne Dyskinesien um vier Stunden verlängert. Allerdings hatten 94 % der mit LCIG behandelten Patienten im Verlauf ein unerwünschtes Ereignis. Das Spektrum reichte dabei von postoperativen Wundinfektionen über Vitamin-B6-Mangel und Stürze bis hin zu Verstopfung und Bauchschmerzen.
Die LECIG-Pumpe ist im Vergleich zur LCIG-Pumpe kleiner und leichter, wodurch sie einen höheren Tragekomfort bieten könnte, meinte Dr. Pötter-Nerger. In einem Milliliter Gel sind 20 mg Levodopa, 20 mg Entacapone und 5 mg Carbidopa enthalten. Die klinische Antwort von LECIG ist vergleichbar mit der von LCIG. Mit Spannung erwartet wird der Kollegin zufolge die subkutane L-Dopa-Pumpe. Die Pumpe des Unternehmens von Abbvie könne etwa gleich hohe Plasmaspiegel von L-Dopa erzielen wie bei Behandlung mit LCIG. Auch die OFF-Zeit-Reduktion sei mit -4 h vergleichbar. Daten über ein Jahr sprächen für anhaltend gute Effekte.
Kongressbericht: Parkinson und Bewegungsstörungen – Highlights Digital 2023
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).