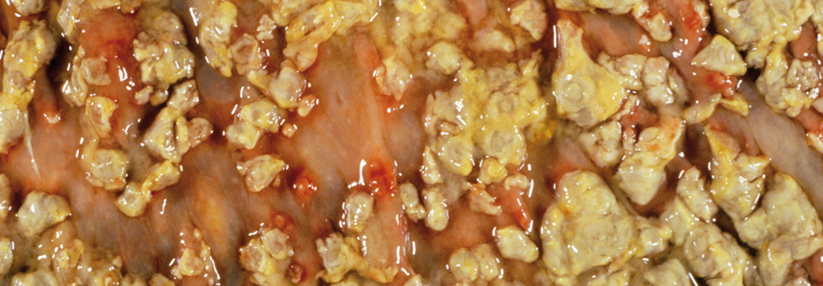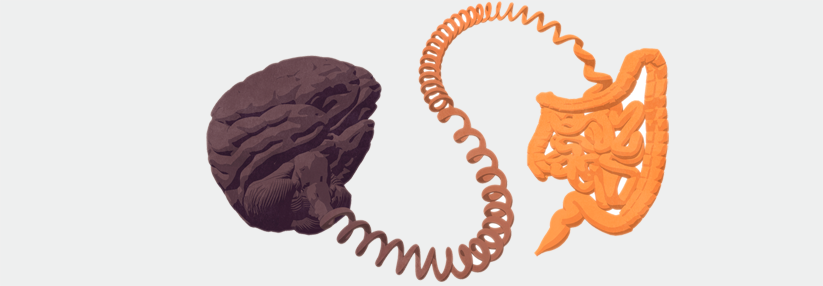Hoffnung auf dauerhafte Heilung?
 Die meisten Strategien verfolgen das Ziel, die Leukozyten in ihrer Aktivität direkt zu blockieren.
© sebra – stock.adobe.com
Die meisten Strategien verfolgen das Ziel, die Leukozyten in ihrer Aktivität direkt zu blockieren.
© sebra – stock.adobe.com
Die Ansätze lassen sich nach ihrer Wirkungsweise unterteilen: Die meisten Strategien verfolgen das Ziel, die Leukozyten in ihrer Aktivität direkt zu blockieren. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Hemmung der Leukozytenwanderung. Dies gelingt zum Beispiel, indem die Zelladhäsion unterbunden wird.
Hemmung der Leukozyten
Das Zytokin TNF ligand-related molecule 1 (TL1A) verstärkt die Immunantwort und gilt zudem als Treiber für Fibrose. Ein entsprechender Inhibitor könnte daher nicht nur einen antientzündlichen, sondern auch einen antifibrotischen Effekt vermitteln, so Prof. Danese. Als vielversprechende Kandidaten gelten u. a. Tulisokibart und Duvakitug. In einer Phase-2-Studie erreichten unter Ersterem deutlich mehr Menschen mit moderater bis schwerer Colitis ulcerosa eine klinische Remission, eine endoskopische Verbesserung sowie eine Mukosaheilung als unter Placebo. Der TL1A-Inhibitor erwies sich zudem als sicher. Auch Duvakitug zeigte in einer Phase-2b-Studie eine gute Wirkung sowohl bei Colitis ulcerosa als auch bei Morbus Crohn.
Eine entzündungshemmende Wirkung bei mittlerer bis schwerer Colitis ulcerosa zeigte auch der niedermolekulare Wirkstoff Obefazimod: Dieser verstärkt das selektive Spleißen einer nicht-kodierenden mRNA und fördert so die Bildung von miRNA-124. Die erhöhte Expression dieser microRNA führt zu einer Reduktion inflammatorischer Zytokine, darunter die Interleukine IL-6, IL-23, IL-1 und TNFa.
Eine weitere Zielstruktur bietet das auf T-Zellen exprimierte rezeptor programmed cell death protein 1 (PD-1). Die Bindung entsprechender Liganden reduziert die T-Zell-Proliferation und die Sekretion proinflammatorischer Zytokine. Mit Rosnilimab, einem PD-1-Agonisten, könnte man die Immunantwort daher modulieren. Die Wirkung bei rheumatoider Arthritis ließ sich bereits bestätigen; die Ergebnisse einer Phase-2-Studie für Colitis ulcerosa sollen Ende 2025 erscheinen.
Die Serin/Threonin-Kinase RIPK1* spielt eine Rolle bei der Regulation von Inflammation, Apoptose sowie Nekrose. RIPK1-Hemmer seien vor allem von daher interessant, dass sie ein breites Wirkspektrum bieten und sich somit Signalkaskaden verschiedener Proteine modulieren ließen, darunter TNFa, TLR3 und TLR4, betonte Prof. Danese.
Tyrosinkinase 2 (TYK2) ist ein Vertreter der JAK-Familie; die Inhibiton gilt jedoch als selektiver als die der Januskinasen 1 bis 3. TYK2-Blocker wie Zasocitinib könnten daher mit einer geringeren Toxizität einhergehen als die bisherigen JAK-Kandidaten.
IL-23-Hemmer wie Ustekinumab, Risankizumab und Guselkumab sind in der Therapie von CED ebenfalls etabliert. Sie werden subkutan oder intravenös verabreicht. In aktuellen Untersuchungen verfolgt man daher einen Ansatz zur oralen Gabe.
Hemmung der Leukozytenwanderung
Die Adhäsion und Extravasation der Leukozyten lässt sich u. a. durch Integrinantagonisten unterbinden. Bereits bewährt hat sich der Antikörper Vedolizumab. Phase-2-Studien lieferten zudem vielversprechende Ergebnisse für niedermolekulare Verbindungen, die sich ebenfalls gegen a4b7-Integrin richten, aber eine orale Gabe ermöglichen sollen.
Ein weiteres Target bietet der Sphingosin-1-phosphat-Rezeptor1 (S1PR1). Dieser wird von Leukozyten exprimiert und reguliert die Migration. Prof. Danese nannte als möglichen S1PR1-Modulator Tamuzimod. Der Wirkstoff erwies sich bei moderater bis schwerer Colitis ulcerosa sowohl in einer 13-wöchigen Induktionsphase als auch während einer 52-wöchigen Erhaltungstherapie als effektiv und wurde gut vertragen.
* receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1
Quelle: 20. Kongress der European Crohn’s and Colitis Organisation
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).