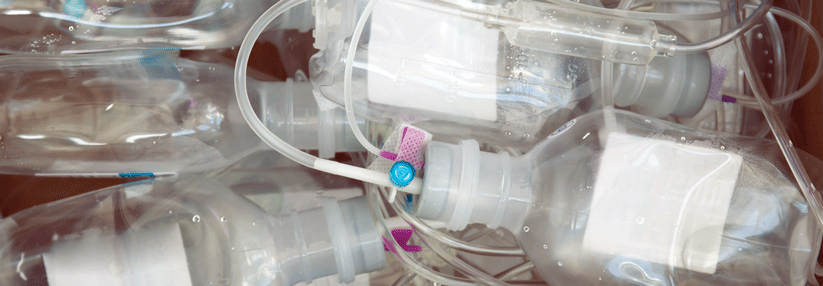Langzeit-Folgen von Chemotherapie werden vernachlässigt
Ein wichtiges Beispiel für eine oft erst Jahrzehnte nach der Krebstherapie zum Tragen kommende Langzeitkomplikation ist die Kardiotoxizität, wie Privatdozentin Dr. Georgia Schilling von der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg erinnerte. Eine mediastinale Bestrahlung erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen um den Faktor zwei bis sieben. Nach einer anthrazyklinhaltigen Chemotherapie tragen Patienten ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für kongestives Herzversagen und kardiovaskuläre Ereignisse.
Das Tückische: Auch nach 20 bis 30 Jahren – wenn die frühere Tumortherapie längst in Vergessenheit geraten ist – steigt das Risiko für Herzerkrankungen noch an. Die Kardiotoxizität der Strahlentherapie (radiation induced heart disease – RIHD) reicht von klinisch inapparenten histopathologischen Veränderungen und subklinischen Schäden an Klappenapparat, Reizleitungssystem und Myokard bis zum letalen strahleninduzierten Koronarsyndrom.
Bestrahlung erhöht KHK-Risiko auf das Siebenfache
Man muss bei etwa 10 % der Patienten nach einer Mediastinalbestrahlung mit manifesten Herzerkrankungen rechnen – und auch hier beginnen die Probleme meist erst nach mehreren Jahrzehnten. Durch eine zusätzliche anthrazyklinhaltige Chemotherapie, z.B. mit Doxorubicin oder Epirubicin, wird die Toxizität potenziert.
Auch bei den neueren zielgerichteten Substanzen muss zum Teil eine Kardiotoxizität mit ins Kalkül gezogen werden, so die Onkologin. So kommt es unter dem gegen HER2-gerichteten Antikörper Trastuzumab in 1 % der Fälle zu einer schweren Herzinsuffizienz (NYHA III-IV), bei 2 % zur symptomatischen Pumpschwäche und bei 5 % zu einer objektivierbaren kardialen Dysfunktion. Im Unterschied zu Anthrazyklinen und Strahlentherapie ist die trastuzumabinduzierte Kardiopathie nicht streng dosisabhängig, tritt vor allem zu Beginn der Behandlung auf und ist in der Regel zwei bis vier Monate nach Beendigung reversibel.
Antikörper können zu akuter Herzinsuffizienz führen
Auch für Lapatinib ist eine Kardiotoxizität bei 1,5–2,2 % der Fälle gezeigt worden – nicht aber für Pertuzumab. Empfehlungen für Monitoring und Therapie der Kardiotoxizität gibt es bisher für eine anthrazyklinhaltige Chemotherapie. Vor der Therapie wird eine kardiologische Basisuntersuchung einschließlich Echokardiographie durchgeführt.
Während der Therapie ist dann Troponin I (TnI) der wichtigste Serummarker. Ist TnI während der Chemotherapie nicht erhöht, wird nach der Therapie über ein Jahr alle drei Monate ein Echo durchgeführt, danach einmal im Jahr. Sobald dabei eine linksventrikuläre Dysfunktion festgestellt wird, erhalten die Patienten ACE-Hemmer und Betablocker.
Troponin I ist der wichtigste Marker während Chemotherapie
Bei Patienten mit erhöhten TnI-Spiegeln während der Therapie kann das nach jedem Zyklus bestimmte Herzenzym als Serummarker genutzt werden. Bleibt es nach der Chemo erhöht, erhalten die Patienten für ein Jahr Enalapril und ein Jahr lang erfolgt alle drei Monate eine Echo-Kontrolle. Über weitere fünf Jahre wird dann alle sechs Monate mittels Echo kontrolliert. Bei Krebspatienten mit negativem TnI nach der Chemo reicht eine jährliche Echo-Kontrolle aus.
Ein weiteres häufiges Problem sind chemotherapieinduzierte Polyneuropathien (CIPN), die durch zahlreiche Therapeutika wie Platinderivate, Taxane, Vincristin, Bortezomib oder Thalidomid ausgelöst werden können. In der Regel gelten die meist an den Extremitäten auftretenden überwiegend sensiblen Polyneuropathien als innerhalb von sechs bis acht Monaten reversibel. Es kann aber auch wesentlich länger dauern, bis die Beschwerden ganz verschwinden, und auch über eine dauerhafte Persistenz der Nervenbeschwerden wird berichtet, betonte Dr. Schilling.
Bisher ist keine Polyneuropathie-Prävention möglich
Therapeutisch ist bei der CIPN schon sehr viel versucht worden – leider alles ohne durchschlagenden Erfolg. Das Gleiche gilt für eine Prävention. Hier weiß man bisher nur, dass Acetyl-L-Carnitin (ALC), Amifostin, Amitryptilin, Mg/Ca, GSM, Nimodipin, All-Transretinsäure oder Vitamin E mit Sicherheit keinen schützenden Effekt haben – für andere Substanzen wie N-Acetylcystein, Carbamazepin, Glutamat oder Omega-3-Fettsäuren reicht die Datenlage für eine Empfehlung nicht aus. Bei einer schmerzhaften Polyneuropathie hat sich Duloxetin als wirksam erwiesen – eine Zulassung für die Indikation fehlt aber.
Ein weiteres besonders für junge Patienten wichtiges Problem in der Langzeit-Nachbetreuung ist die Infertilität. Bei zahlreichen Zytostatika ist die Infertilität als Langzeitkomplikation gesichert oder zumindest wahrscheinlich. Bei jungen Männern wird das Problem in der Regel schon vor der Therapie angesprochen und eine Kryokonservierung der Spermien angeboten. Etwas vernachlässigt werden dagegen die Frauen, die auch oft unter einer Ovarialinsuffizienz mit Infertilität, Osteoporose und vorzeitigem Klimakterium zu leiden haben.
GnRH-Antagonisten versprechen wirksamen Ovarschutz
Die Kryokonservierung von Eizellen oder Ovar ist noch experimentell. Eine Möglichkeit könnte der Einsatz von GnRH-Agonisten zum Ovarschutz sein. In einer Metaanalyse konnte hier immerhin eine 57%ige Risikoreduktion für eine ovarielle Insuffizienz nach der Chemotherapie gezeigt werden.
In einer ganz aktuellen Studie erhielten 218 prämenopausale HR-negative Mammakarzinom-Patientinnen Goserelin (3,6 mg s.c. alle vier Wochen) während der cyclophosphamidhaltigen Chemotherapie (eine Woche vorher bis zwei Wochen nach Behandlungsbeginn) oder Placebo.
Die Rate an Ovarialinsuffizienz war unter dem GnRH-Agonisten deutlich reduziert (8 vs. 22 %) und mehr Frauen berichteten danach von mindestens einer Schwangerschaft (21 vs. 11 %). Dabei war die Rate an Fehlgeburten und anderen Schwangerschaftskomplikationen in beiden Gruppen gleich, sodass anzunehmen ist, dass die Goserelin-Therapie nicht schadet.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V., Frühjahrstagung, 2015
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).