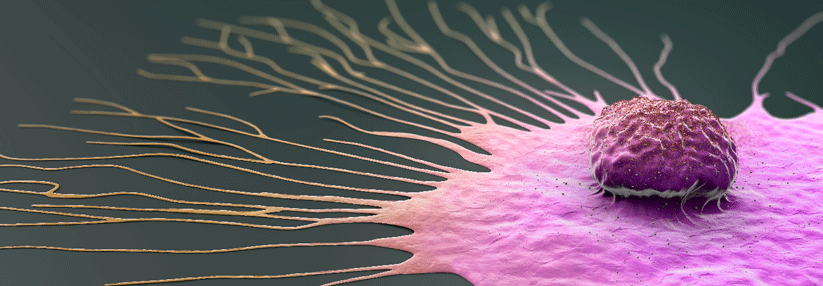Was bei chronischem Husten zu tun ist
 Wichtige Anhaltspunkte für die Ursache eines Hustens ergeben sich aus der Dauer.
© nenetus – stock.adobe.com
Wichtige Anhaltspunkte für die Ursache eines Hustens ergeben sich aus der Dauer.
© nenetus – stock.adobe.com
Wichtige Anhaltspunkte für die Ursache eines Hustens ergeben sich aus der Dauer. Als akut wird eine Tussis bezeichnet, wenn die Symptomatik nicht länger als drei Wochen anhält. Subakut bedeutet drei bis acht Wochen, chronisch seit mehr als acht Wochen. Zum anderen spielt es auch eine Rolle, ob Auswurf besteht oder nicht.
Die häufigsten Ursachen eines akuten Hustens, der relativ rasch wieder von selbst abklingt, sind Erkältungen, allergische Rhinitis und Rhinosinusitis. Bis zu zwei Monate können vergehen bei infektgetriggerter bronchialer Hyperreagibilität, anhaltender Allergenexposition gegenüber Pollen, postviraler Rhinosinusitis, Pneumonie und Pertussis. Genauso lange hinziehen kann es sich bei Infektion mit Adenoviren, Mykoplasmen, SARS-CoV-2 und im Fall einer postinfektiösen Tussis, heißt es in der S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und weiterer Fachgesellschaften.
Fieber und Hämoptysen erfordern genaue Diagnostik
Bei akuter und subakuter Symptomatik sollte sich die Diagnostik auf die Erhebung der Krankengeschichte und die körperliche Untersuchung beschränken. Eine Ausnahme bilden Alarmzeichen wie hohes Fieber, Atemnot, Hämoptysen und Tumorverdacht. Dann ist eine genauere Abklärung indiziert. Von einer antibiotischen Therapie bei akutem Husten rät die Autorengruppe um Dr. Peter Kardos, Klinik Maingau vom Roten Kreuz in Frankfurt am Main, ab. Frei verkäufliche Sekretolytika und Antitussiva dürfen eingesetzt werden.
Hinter einem chronischen Husten können sich beispielsweise pneumologische und obere Atemwegserkrankungen verbergen, ebenso Schluckstörungen, Lungenödem und Reflux. In bis zu einem Drittel der Fälle findet sich aber keine Ursache. So entwickeln etwa 30 % der Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion eine anhaltende Symptomatik im Sinne eines refraktären oder idiopathischen Hustens oder als Zeichen einer interstitiellen Lungenerkrankung.
Wenn Arzneimittel schuld sind
Ein chronischer Husten kann auch als unerwünschte Wirkung bestimmter Medikamente auftreten. Zu nennen sind in erster Linie ACE-Hemmer. Bei Klagen über chronischen Husten gilt es, den kompletten Medikationsplan der Patientin oder des Patienten auf potenziell hustenauslösende Substanzen zu überprüfen. ACE-Hemmer sollten in jedem Fall vorsorglich durch einen Vertreter einer anderen Substanzklasse ausgetauscht werden.
Von einem refraktären chronischen Husten (RCC*) spricht man, wenn die Beschwerden trotz Therapie der vermeintlichen Grunderkrankung fortbestehen. Die Abkürzung UCC** bezeichnet chronische Symptome ohne erkennbaren Auslöser. Zwei Drittel der von einem RCC oder UCC Betroffenen sind postmenopausale Frauen. Pathophysiologisch beruht das Phänomen auf einer erhöhten Sensitivität des Hustenreflexes und ist als eigenständige Erkrankung zu diagnostizieren. Auch chronisch inflammatorische und allergische Erkrankungen der oberen Atemwege können einen andauernden Husten auslösen, ebenso laryngeale Obstruktion oder Hypersensitivität.
Symptome wie Sodbrennen, saures Aufstoßen und Regurgitation wecken den Verdacht auf eine refluxbedingte Genese. Nur dann wird eine Refluxtherapie empfohlen. Wenn ösophageale Beschwerden fehlen, aber sonst keine andere Ursache gefunden wird, hilft eventuell die sorgfältige gastroenterologische Abklärung weiter.
Auch eine bronchiale Hyperreagibilität oder eine eosinophile Entzündung der Bronchien ohne klassisches Asthma können Husten auslösen. Im Verdachtsfall rät das Leitliniengremium zu einer unspezifischen inhalativen Provokationstestung (nur bei Hyperreagibilität) bzw. zu einer probatorischen Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden (ICS) oder ICS plus lang wirksames Beta-2-Sympathomimetikum über vier Wochen.
Die Basisdiagnostik bei anhaltendem Husten umfasst stets einen Röntgen-Thorax und eine Lungenfunktionsprüfung, heißt es in der Leitlinie. Wie es dann weitergeht, hängt von der klinischen Verdachtsdiagnose ab. Infrage kommen HNO-Untersuchungen, CT-Thorax, Bronchoskopie, Schlafapnoe- und Refluxdiagnostik sowie die kardiologische und neurologische Abklärung.
Individuelle Therapie mit Atemphysio und Logopädie
Die Therapie orientiert sich am individuellen Bedarf. Bei produktivem Husten (inkl. Mukusretention) hat sich die Atemphysiotherapie mit sekretmodulierenden Techniken bewährt. Kranke mit trockenem Reizhusten profitieren von Verfahren, die diesen verhindern. Bei laryngealer und pharyngealer Hyperreagibilität sollte Logopädie angeboten werden.
In der medikamentösen Therapie steht die Behandlung etwaiger Grundleiden an erster Stelle. Bei akutem oder subakutem Husten werden pflanzliche und synthetische Sekretomotorika und Antitussiva mit nachgewiesener Wirksamkeit empfohlen. Sie sind allerdings nicht für die Langzeitanwendung zugelassen. Gegen chronischen Husten können intermittierend off label Sekretomotorika, Antitussiva, Neuromodulatoren und niedrig dosiertes retardiertes Morphin verschrieben werden. Letzteres ist ausdrücklich auch in der palliativen Situation erlaubt.
* Refractory Chronic Cough
** Unexplained Chronic Cough
S2k-Leitlinie „Fachärztliche Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten“; AWMF-Register-Nr. 020-003; www.awmf.org
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).