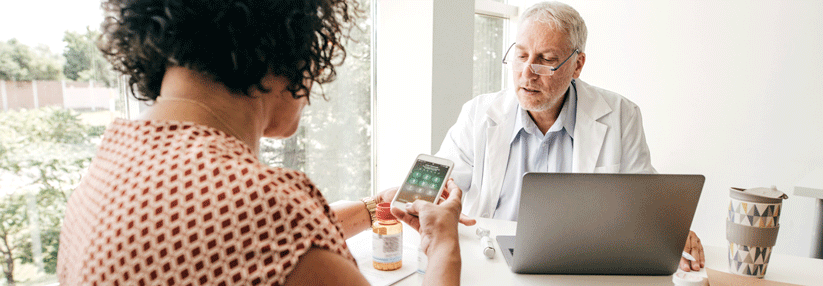DGIM 2022 Fragen Sie zuerst den Symptom-Checker!
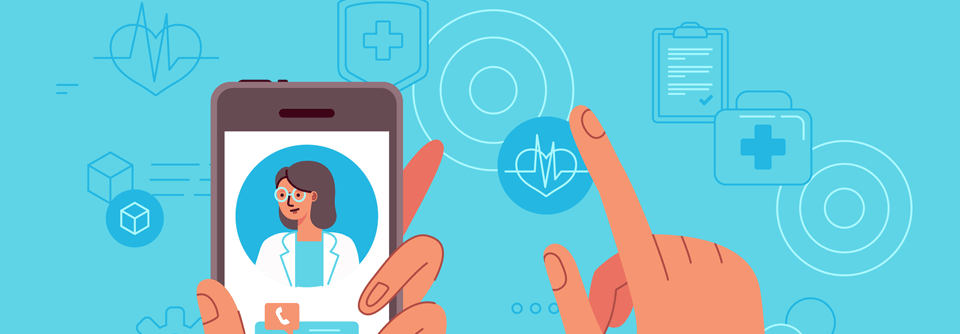 Um die Verordnungspraxis zu erleichtern, wäre es wichtig, dass Ärzte und Praxisteams kostenfreie Testzugänge nutzen könnten.
© iStock/venimo
Um die Verordnungspraxis zu erleichtern, wäre es wichtig, dass Ärzte und Praxisteams kostenfreie Testzugänge nutzen könnten.
© iStock/venimo
Mit einem Schmunzeln zitiert Prof. Dr. Martin Möckel, Kardiologe an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, aus dem diesjährigen Report der Techniker Krankenkasse (TK) zu Digitalen Gesundheitsanwendungen: „Auffällig ist, dass in Berlin – wo auch die meisten DiGA-Hersteller sitzen – die Verordnungsquote am höchsten ist.“ Zudem sind die DiGA-Nutzer (zwei Drittel sind weiblich) mit einem Durchschnittsalter von 45,5 Jahren digital erfahren. Und dennoch fallen selbst in der zentralen Notaufnahme in Berlin-Mitte nur selten Patienten auf, die sich mit Bezug auf eine KI-basierte „Symptom-Checker“-App einweisen, etwa mit den Worten „Ada sagt: Ich habe ein Magengeschwür.“
Was macht das eigentlich mit einem Arzt, der mit solch einer Vorgabe konfrontiert wird? Und was bewirken solche Selbst-Ersteinschätzungen beim Anwender? In der Charité wird das jetzt mit Personen, die sich auf eigene Faust in die Notaufnahme begeben haben, untersucht.
Prof. Möckel geht davon aus, dass sich im professionellen Bereich das Ersteinschätzungs-Instrument „SmED“, das in Variationen am Telefon (116117), am Notaufnahme-Tresen, im Rettungswagen und zur Patienten-Selbsteinschätzung genutzt werden kann, als Standard in Deutschland etabliert. Die Herausforderung bestehe allerdings im sicheren strukturierten Datentransfer, um Verwechslungen zu vermeiden.
Bisher noch keine kardiologische DiGA
Die Zukunftsfelder von Apps in der individuellen Patientenversorgung sieht der Arzt u.a. bei der Diagnostikunterstützung mit Künstlicher Intelligenz, z.B. bei der Auskultation, und im Datensupport. Ein Hausarzt habe nicht die Zeit, die großen Mengen individueller Daten, die z.B. aus Wearables sprudeln, selbst zu durchforsten. Dafür bedürfe es einer KI, die dem Arzt eine Vorauswertung liefert. Dass die lernende Software dem Mediziner damit auch einen Teil seiner kreativen Leistung abnimmt, werde noch berufsethisch zu diskutieren sein.
Wie sieht es bei der Evidenz von Gesundheits-Apps aus? Wer eine solche Software anwendet, erhofft sich davon einen medizinischen Nutzen. Dennoch fallen wissenschaftliche Aussagen dazu nicht leicht, erklärt Prof Möckel. Denn auch andere Effekte, etwa ein schnellerer Zugang zur Versorgung, spielen im komplexen Geschehen eine Rolle. Überrascht stellt der Berliner Internist fest, dass es trotz der Verbreitung von Smartwatches und Fitnesstrackern, die z.B. Blutdruck und Puls messen, noch keine kardiologische DiGA gibt.
Allerdings kann er auf das Beispiel der dauerhaft zugelassenen DiGA „deprexis“ verweisen, bei der „eine richtig gute Evidenz“ aufgrund längerer Erfahrung vorliegt. Das onlinebasierte Selbsthilfeprogramm zur Therapieunterstützung von Erwachsenen mit Depressionen und depressiven Verstimmungen ergänzt die Behandlung beim Haus-, Facharzt oder Psychotherapeuten. Möglicherweise falle es Patienten sogar leichter, anonym mit einem Avatar über psychische Belastungen oder z.B. Probleme beim Einsatz des Blutdruckmessgeräts zu sprechen als mit einem echten Professional, vermutet Prof. Möckel.
Der Blick ins DiGA-Verzeichnis des BfArM zeigt allerdings: Von 31 zulasten der GKV verordnungsfähigen Anwendungen (Stand Ende April) sind 19 nur vorläufig zugelassen. D.h. sie müssen den Nachweis eines medizinischen Nutzens oder einer patientenrelevanten Struktur-/Verfahrensverbesserung erst noch erbringen, um dauerhaft gelistet zu werden. Das ist bisher zwölf Programmen gelungen. Bei zwei DiGAs zogen die Anbieter ihren Antrag auf Listung nach der Erprobungsphase zurück. Sie sind – zumindest bis auf Weiteres – gestrichen (siehe Kasten).
Erprobt und gestrichen
Dass rund anderthalb Jahr nach dem Start des DiGA-Verzeichnisses die ersten Apps von der Erstattung wieder ausgeschlossen wurden, kann man positiv sehen: Der Mechanismus der Erprobung funktioniert, im GKV-Katalog bleibt nur, wer signifikant einen Nutzen bzw. Verbesserungen nachweist. Die Kassen beklagen natürlich auch die Kosten: Ein Jahr lang für etwas Geld ausgegeben, das die Evidenz schuldig blieb. Laut Techniker Krankenkasse (TK) überwiesen die gesetzlichen Versicherer für die Migräne-App M-Sense in einem Jahr mehr als eine Million Euro, ehe das Produkt im April von der BfArM-Liste „gestrichen“ wurde. Der Hersteller hatte sich nach der RCT-Studie entschieden, „die Aufnahme ins DiGA-Verzeichnis nicht weiter zu verfolgen“. Auch der Anbieter der Krebs-Therapiebegleitung Mika zur Reduktion psychischer Belastung zog sein Produkt „vorübergehend“ aus dem Verzeichnis ab. Mit einer stärkeren Evidenz durch neue Studienergebnisse will man die permanente Anerkennung noch erreichen. Funfact: Bei den beiden DiGAs handelt es sich um die Apps mit den höchsten Genehmigungsanteilen. So wurde M-Sense laut GKV-Spitzenverband (bis September 2021) zu 19 % mit einer direkten Genehmigung durch die Kasse bezogen (und zu 81 % aufgrund eines Rezepts). Bei Mika betrug der Kassenanteil 30 %. Noch höhere Quoten weist die TK aus: Ihre Kunden erhielten M-Sense zu 25 % genehmigt. Bei Mika gab die TK in 46 % der Fälle selbst grünes Licht.
Eine Arbeitsgruppe der DGIM, darunter auch Prof. Möckel, hat sich mit der praktischen Anwendung von DiGA in der Inneren Medizin beschäftigt. Sie notiert: Um die Verordnungspraxis zu erleichtern, wäre es wichtig, dass Ärzte und Praxisteams (längerfristig) kostenfreie Testzugänge nutzen könnten, um sich mit den Produkten vertraut zu machen. Hilfreich wären auch Schulungen, damit das Praxisteam z.B. Anwendungsfragen von Patienten schnell beantworten kann. Außerdem sei der ärztliche Aufwand adäquat zu honorieren. Prof. Möckel gelangt zu dem Eindruck: „DiGA stellen innovative digitale Therapien dar. Ihre Operationalisierung und Entwicklung stehen aber erst am Anfang.“
Quelle: 128. Kongress der DGIM