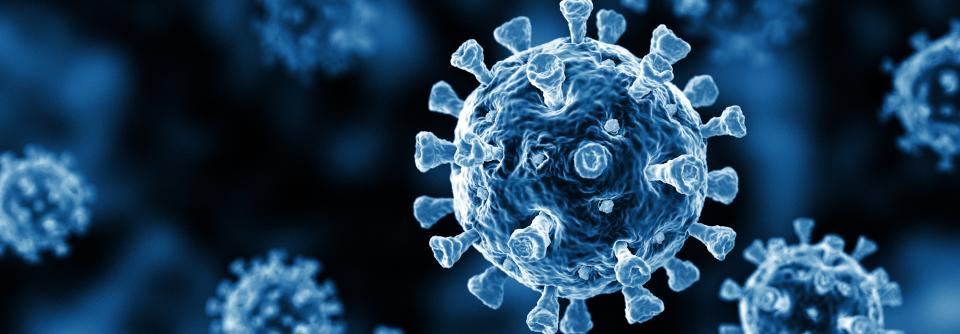Chronisches Fatigue-Syndrom manifestiert sich meist durch Belastungsintoleranz
 Die meisten der Patienten sind nicht mehr arbeitsfähig. (Agenturfoto)
© StockPhotoPro – stock.adobe.com
Die meisten der Patienten sind nicht mehr arbeitsfähig. (Agenturfoto)
© StockPhotoPro – stock.adobe.com
Sehr wichtig sei es, die Symptome Müdigkeit und Fatigue nicht mit dem eigenständigen Krankheitsbild des Chronic Fatigue Syndroms gleichzusetzen, betonte Dr. Claus-Hermann Bückendorf, Umweltmediziner aus Kiel. Das auch kurz als CFS bezeichnete Syndrom hat hierzulande etwa 300 000, oftmals jüngere Menschen im Griff, wobei der Erkrankungsgipfel zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr liegt. Die meisten der Patienten sind nicht mehr arbeitsfähig, nur bei 10–30 % bessert sich die Multisystemerkrankung.
Zu den Auslösern zählen laut Dr. Bückendorf häufig akute Infektionen, z.B. mit dem Epstein-Barr-Virus oder mit Coxsackie-Viren. Klinisch ist die CFS durch die Trias Fatigue, neurokognitive und immunologische Symptome gekennzeichnet. Betroffene berichten von einer anhaltenden schweren Müdigkeit, ohne zuvor aktiv gewesen zu sein. Hinzu kommen starke Konzentrationsprobleme und beeinträchtigte Wahrnehmung, gelegentlich periphere sensorische sowie motorische Störungen. Viele Betroffene sind reiz- und stressempfindlich.
Einen spezifischen Labortest oder Biomarker gibt es nicht
Im Verlauf treten autonome Dysfunktionen sowie Schmerzen in Muskeln, Gelenken und im Kopf auf. Bei einem Teil der Patienten kommt es zu Autoimmunreaktionen (s. Kasten). Eines der zuverlässigsten Zeichen ist die Belastungsintoleranz, weiß der Kollege. „Während müde Patienten oft noch eine bis zwei Stunden spazieren oder radfahren können, legen schon ein paar Schritte CFS-Patienten für Tage lahm.“
Vermutlich eine Autoimmunerkrankung
Das CFS kanadisch erkennen
- erhebliche Erschöpfung
- Schlafstörungen
- Schmerzen (v.a. Myalgien)
- zumindest zwei neurologische und kognitive Störungen
- vegetative, neuroendokrine und immunologische Symptome
Quelle: Carruthers BM et al. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2003; 11: 7-115
* Composite Autonomic Symptom Score
Quelle: 125. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin