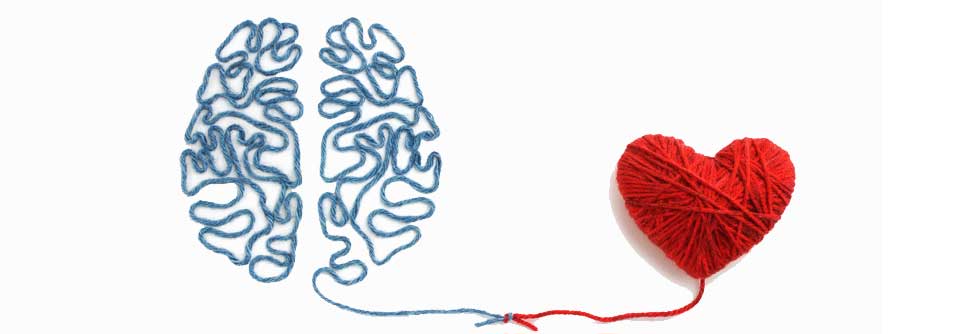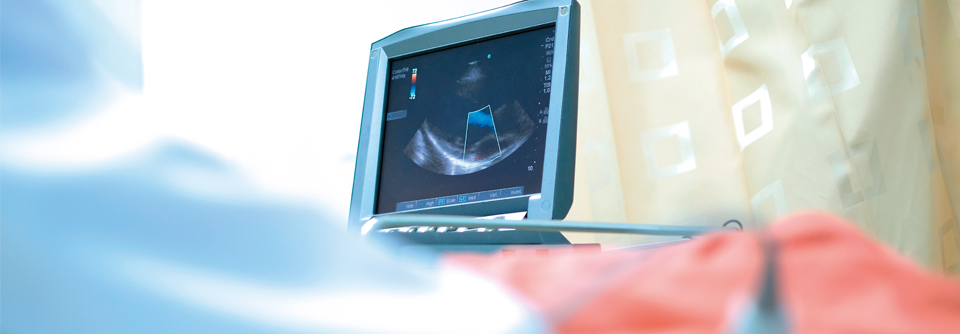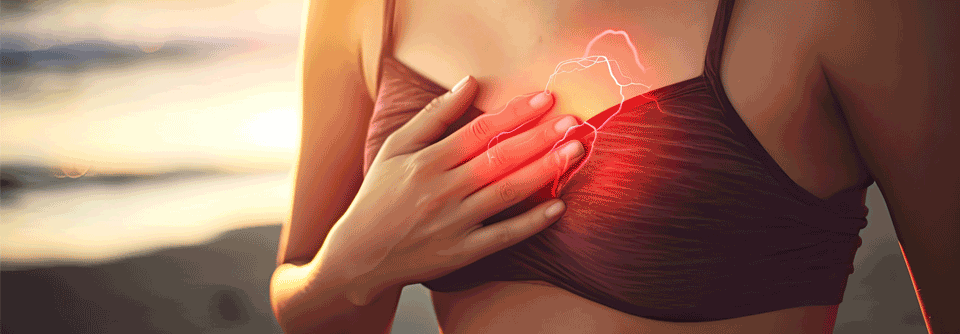
Herzerkrankung Der Blick hinter die Fassade
 Nur eine biopsychosoziale Simultandiagnostik kann psychische und körperliche Symptome vollumfänglich abdecken und einordnen.
© Berit Kessler – stock.adobe.com
Nur eine biopsychosoziale Simultandiagnostik kann psychische und körperliche Symptome vollumfänglich abdecken und einordnen.
© Berit Kessler – stock.adobe.com
Im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen sind Ängste und Depressionen die häufigsten psychischen Leiden. Die Bandbreite an Störungsbildern, mit denen man es im Bereich der sogenannten Psychokardiologie zu tun hat, ist groß, schreibt Dr. Boris Leithäuser, niedergelassener Internist in Hamburg. Sie reicht vom schwer herzkranken Patienten mit Depressionen bis hin zum kardial Gesunden mit somatoformer Störung und herzbezogener Angst.
Ob bei einem Patienten eine manifeste Herzkrankheit vorliegt oder nicht: Stets sollte man psychische Effekte auf die körperlichen Symptome und krankheitsreaktive Auswirkungen auf die seelische Gesundheit bedenken. Gefordert ist also eine biopsychosoziale Simultandiagnostik, erläutert Dr. Leithäuser. Zugleich müssen die kardiovaskulär bedingten körperlichen Beschwerden leitliniengerecht abgeklärt werden.
Kardiovaskulär bedingte Beschwerden abklären
In einem ersten Ansatz kann man zwischen den typischen Symptomen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und eher atypischen und damit möglicherweise somatoform bedingten Beschwerden unterscheiden. Die atypische, somatoforme Symptomatik umfasst etwa:
- stichartige Thoraxbeschwerden
- erhöhte Pulsfrequenz oder das Gefühl von Atemnot in Ruhe
- Palpitationen, vor allem nachts
- Übelkeit, Globusgefühl
- Schwindel, vermehrtes Schwitzen ohne körperliche Belastung
Begleitend ist nach psychischen Symptomen zu fragen:
- Angst, auch vor oder wegen der Krankheit
- Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, innere Unruhe, Erschöpfung
- Schlafstörungen, Albträume, nächtliches Zähneknirschen
- Tinnitus, das Gefühl von Stress
- Libidoverlust
Ergeben sich aus der Vorgeschichte des Patienten keine Hinweise auf eine psychische oder somatoforme Symptomatik oder führt die kardiale Diagnostik zu keinem auffälligen Befund, ist ein tiefer gehendes Gespräch angezeigt. Dabei geht es in offen gestellten Fragen um das allgemeine Befinden des Patienten, seine Lebensumstände, Familie, Beruf oder seine finanzielle Situation. Mit speziellen Screeningfragen nach Traurigkeit, angstbesetzten Situationen, somatischen Beschwerden, seelischen Belastungen oder Traumata lassen sich eventuell bestehende Symptome eingrenzen. Bei Anzeichen einer psychischen Komorbidität erlauben spezielle Fragebogen die genaue Evaluation.
Allerdings sind die Ergebnisse solcher Tests nur vermeintlich objektiv, schreibt Dr. Leithäuser. Denn trotz der scheinbar eindeutigen Zahlenwerte spiegeln die Scores lediglich eine momentane subjektive Einschätzung des Patienten wider. Jedes auffällige Ergebnis muss also im persönlichen Gespräch einzeln bewertet werden, so der Autor.
Unter den verfügbaren Fragekatalogen empfiehlt er den Patient Health Questionnaire (PHQ-D), den Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) sowie die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Mit ihnen lassen sich Ängste, eine depressive Symptomatik und somatoforme Beschwerden, Essstörungen und Alkoholmissbrauch einschätzen. Zwei weitere Tests zielen auf eine möglicherweise vorliegende Anpassungsstörung wie ein pathologisches Vermeidungsverhalten, Intrusion oder Übererregung ab: der Adjustment Disorder – New Module 20 (ADNM) und die revidierte Fassung der Impact of Event Scale (IES-R). Speziell für herzkranke Patienten ist der Herzangstfragebogen (HAF-17) konzipiert.
Recherchen des Patienten mit Feingefühl begegnen
Eine stabile Arzt-Patienten-Beziehung erleichtert die Diagnostik ungemein, so Dr. Leithäuser. Kommunikatives Feingefühl ist dann gefordert, wenn ein Patient dysfunktionale Überzeugungen im Rahmen einer subjektiven Krankheitstheorie präsentiert. Und besonderer Flexibilität und Empathie bedarf es, wenn der Patient seine Beschwerden anhand einer aufwendigen Recherche im Internet bereits selber eingeordnet hat und nun abschließend um die ärztliche Bestätigung bittet. Auch der Ärger, denn man als Arzt dann empfinden mag, kann diagnostisch hilfreich sein, meint Dr. Leithäuser. Denn schließlich resultieren solche abwehrenden Gefühle aufseiten des Arztes oft aus dem irrationalen Verhalten des Patienten – und können somit auf eine psychische Begleitsymptomatik hindeuten.
Ist der Arzt zum Schluss gekommen, dass psychische Symptome vorliegen, kann ein edukatives Gespräch weiterhelfen. Zudem gilt es, positive Ressourcen des Patienten zu aktivieren und hypochondrische Patienten zu beraten. Hat sich eine psychiatrische Diagnose ergeben oder besteht ein hoher Leidensdruck beim Betroffenen, ist die Überweisung an die Psychiatrie oder eine psychosomatische Klinik angezeigt, um die weiterführende Diagnostik und eine adäquate Therapie einleiten zu können.
Quelle: Leithäuser B. Dtsch Med Wochenschr 2023; 148: 1260-1264; DOI: 10.1055/a-2139-7763