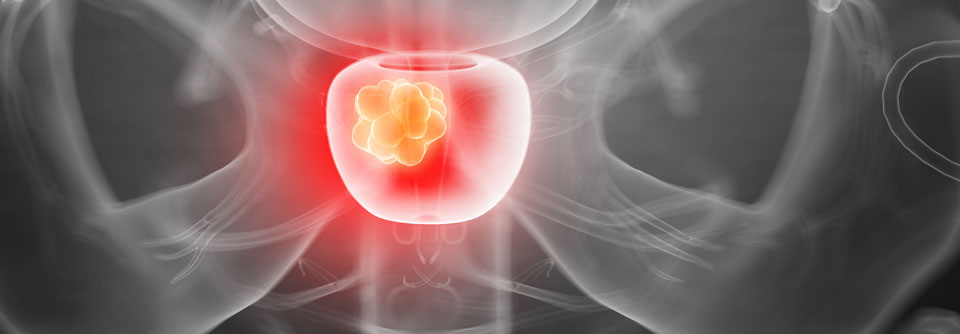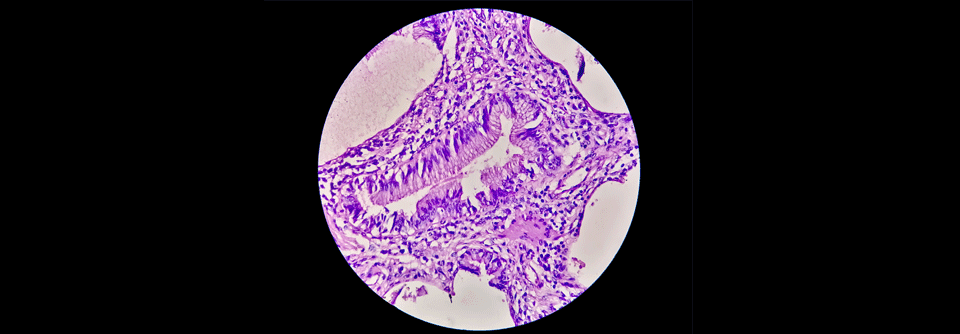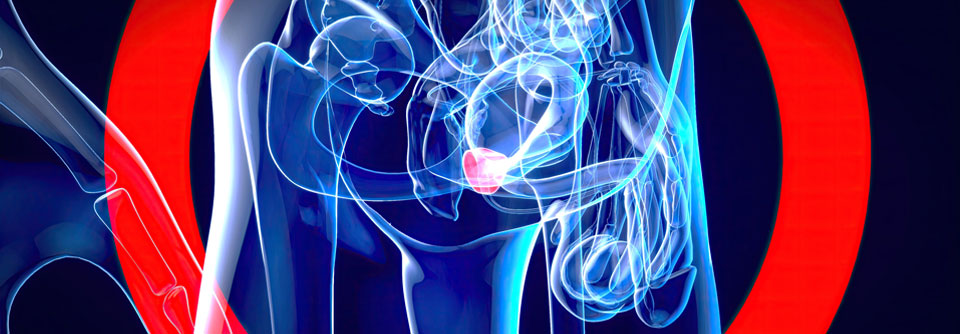
Update für die Früherkennung Für risikoadaptiertes Prostatakrebs-Screening steht alles bereit
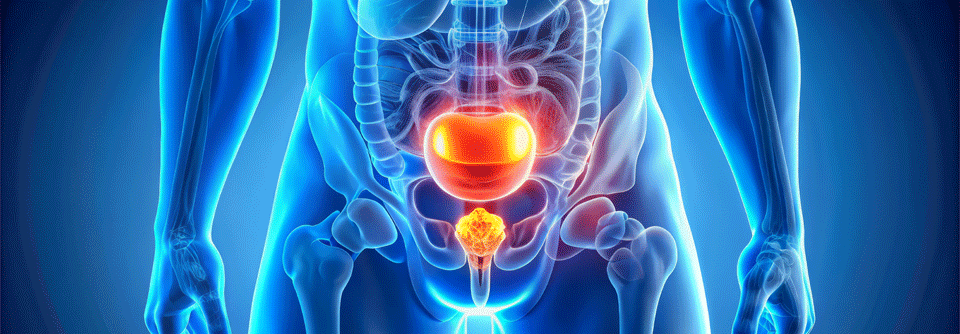 Beim Screening auf Prostatakrebs kommen verschiedene Strategien infrage.
© Arethaawykoff - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Beim Screening auf Prostatakrebs kommen verschiedene Strategien infrage.
© Arethaawykoff - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Beim Screening auf Prostatakrebs kommen verschiedene Strategien infrage. Allen Verfahren gemeinsam ist die hohe Rate an Überdiagnosen. Die Integration von MRT und neuen molekularen Biomarkern könnte die Untersuchungsergebnisse verbessern.
Das Prostatakarzinom ist in Deutschland die häufigste Krebsdiagnose und die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache bei Männern. Organisierte Screeningprogramme sollen helfen, ein Fortschreiten klinisch relevanter Tumoren zu bremsen, Morbidität und Mortalität der erkrankten Männer zu senken und die krebsassoziierten Gesundheitskosten zu reduzieren. Doch die Untersuchungen führen regelmäßig zur Überdiagnose niedrig aggressiver Tumoren, die womöglich keiner sofortigen Therapie bedürfen und zunächst beobachtet werden sollten, schreibt ein Autorenteam um Dr. Anne Hübner von der Universitätsklinik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
In Deutschland haben Männer, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, ab dem 45. Lebensjahr Anspruch auf eine jährliche urologische Früherkennung mittels digital rektaler Untersuchung (DRU). Daten aus der klinischen Versorgung zeigen, dass dieses Verfahren eine Sensitivität von 0,51, eine Spezifität von 0,59 und einen positiven prädiktiven Wert von 0,41 hat. Damit ist die DRU weit weniger effektiv als die Tests auf das prostataspezifische Antigen (PSA), die in Deutschland aber in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen gezahlt werden. So wurde in einer Studie ein Tumor der Vorsteherdrüse bei 45-Jährigen mit der digital rektalen Untersuchung viermal seltener entdeckt als mittels PSA-Test, berichten Dr. Hübner et al. Zudem wird die DRU von den Männern schlecht akzeptiert.
Die PSA-Testung hat aus Sicht der Autorengruppe großes Potenzial, die Früherkennung von Prostatakrebs zu verbessern. Doch beim Einsatz der Methode und bei der Interpretation der Ergebnisse gibt es einiges zu beachten. So ist der PSA-Wert allein wenig spezifisch und wenig sensitiv, woraus Überdiagnosen, unnötige hohe Kosten im Gesundheitssystem und eine starke psychische Belastung der Betroffenen folgen. Zudem kann ein aggressiver Tumor bei einem falsch negativen Ergebnis unentdeckt bleiben.
Lediglich bei Männern im Alter zwischen 45 und 50 Jahren sind die PSA-Tests hinreichend sensitiv und ausreichend spezifisch. Je älter die Patienten bei der Bestimmung des ersten PSA-Wertes sind, desto niedriger liegt die Spezifität des Verfahrens. Die hohe prognostische Bedeutung eines Basis-PSA-Wertes im Alter zwischen 45 und 50 Jahren werde im opportunistischen Screening nicht berücksichtigt, bemängeln die Autorinnen und Autoren. Das unkontrollierte Angebot der PSA-Tests fördere deren unsachgemäßen Einsatz, insbesondere bei älteren Männern, bei denen die Nachteile überwiegen. Regelmäßige PSA-Tests ab einem Alter von 70 Jahren bieten keinen Überlebensvorteil und erhöhen die Gefahr der Überdiagnostik, macht die Expertengruppe deutlich.
Ein deutlich besseres Nutzen-Risiko-Verhältnis bietet die Kombination aus PSA-Test, MRT-Bildgebung und neuen Biomarkern wie dem 4K-Score* oder dem Stockholm3-Risikoscore**. Den Schlüssel zur Optimierung der Früherkennung sieht das Autorenteam in einem personalisierten Screening, das das individuelle Risiko berücksichtigt. Männer mit erhöhtem Risiko sollten intensiver überwacht werden, während man bei geringer Gefährdung auf engmaschige Kontrollen verzichten könne.
*Bluttest aus Gesamt-PSA, freiem und intaktem PSA sowie humanem Kallikrein 2
**Kombination aus PSA-Wert, 232 SNP (single nucleotide polymorphism) und klinischen Daten
Quelle: Hübner A et al. Urologie 2024; doi: 10.1007/s00120-024-02478-1