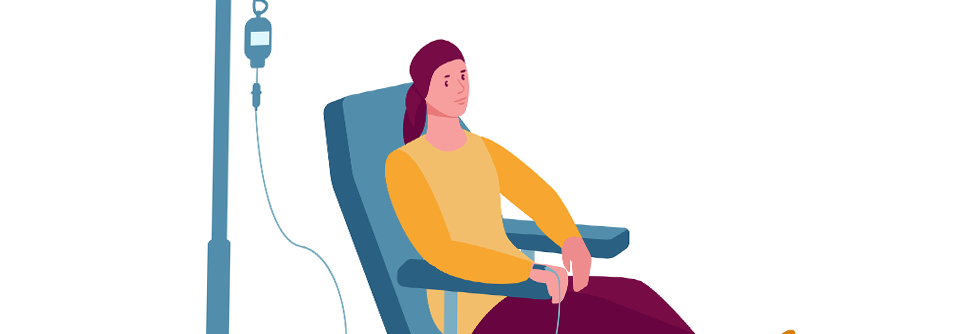Palliativmediziner möglichst früh in die Krebstherapie integrieren
 Die enge Zusammenarbeit eines kompetenten Teams ist das Wichtigste.
© iStock/smartboy10
Die enge Zusammenarbeit eines kompetenten Teams ist das Wichtigste.
© iStock/smartboy10
Die Lebensqualität von Krebspatienten steigt durch den Einsatz von Palliativteams nachweislich, unnötige aggressive Maßnahmen lassen sich durch sie vermeiden. Die Evidenz für die frühzeitige palliativmedizinische Versorgung ist so überzeugend, dass sie 2018 ein eigenes Kapitel in der S3-Leitlinie zum Lungenkarzinom bekommen hat.
Darin wird auf Klasse-A-Niveau empfohlen, Menschen mit nicht-heilbarem Lungenkrebs schon innerhalb der ersten zwei Monate nach Diagnosestellung Palliativberatung und -versorgung zukommen zu lassen. Dr. Wiebke Nehls, Helios Klinikum Emil von Behring, Berlin, betrachtet diese Leitlinie als einen „Leuchtturm in der Onkologie“. Es sei schließlich nicht immer gelungen, die frühzeitige Palliativversorgung so in Leitlinien zu platzieren.
Was heute machbar ist: ein Fallbeispiel
Betroffene anfangs oft irritiert
Bei der palliativmedizinischen Erstberatung, an der zumindest Arzt und Pflegedienst, häufig auch Sozialdienst und Psychologe teilnehmen, werden Symptomlast und individuelle Ressourcen ermittelt und je nach Bedarf Therapien und Begleitmaßnahmen eingeleitet. „Am Anfang erleben wir oft eine gewisse Irritation, warum jetzt schon ein Palliativdienst kommt“, erzählte Dr. Nehls. „Aber mit guter Kommunikation, in der wir uns als zuverlässige Gesprächspartner anbieten, lässt sich die Sorge entkräften.“ Denn Palliativmedizin kommt nicht erst dann zum Zug, wenn die Prognose schlecht und die onkologische Therapie am Ende ihrer Möglichkeiten steht, sondern wenn der Patient Support braucht. Ängste vor Krankheits- und Therapiefolgen können gemindert bzw. genommen werden, wenn der Patient weiß, dass ihm ein kompetentes Team zur Seite steht, betonte die Referentin. Wie sinnvoll der frühe Kontakt ist, zeigt eine Auswertung von 27 Patienten des Helios-Teams: Im Median litten diese bereits bei der Erstdiagnose unter sechs Beschwerden – etwa Schmerzen, Schwäche und Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder Luftnot – die sie moderat bis schwer belasteten. Bei allen wurden konkrete Maßnahmen eingeleitet, die von Symptomkontrolle und Pharmakotherapie bis hin zur Vermittlung psychoonkologischer Betreuung reichten. Die molekularen und Immuntherapien verändern die „Krebslandschaft“ und wirken sich auch auf die Palliativmedizin aus. Zwar haben sich die Prognosen der Patienten durch die neuen Optionen wesentlich gebessert, sie lassen sich aber schwerer vorhersagen. Außerdem profitieren Erkrankte, die in Chemotherapiezeiten als nicht behandlungsfähig galten, vielleicht doch von den neuen Therapien, zumal sie in der Regel besser verträglich sind. Die Gespräche mit den Patienten werden somit anspruchsvoller und zeitintensiver.Kooperation, nicht Konkurrenz!
Individuelle Maßnahmen auf Bedürfnisse abstimmen
Dr. Nehls wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Unterschied besteht zwischen personalisierter Medizin, die auf Bedürfnisse und Therapieziele des einzelnen Patienten zugeschnitten sein sollte, und biologisch personalisierter Therapie, die sich an molekularen und anderen Biomarkern ausrichtet. Beide müssen Hand in Hand gehen, um Patienten trotz der schweren Erkrankung nicht nur eine gute Lebens-, sondern auch eine gute Sterbequalität zu gewährleisten.Quelle: Nehls W. 61. Kongress der DGP (virtuell)