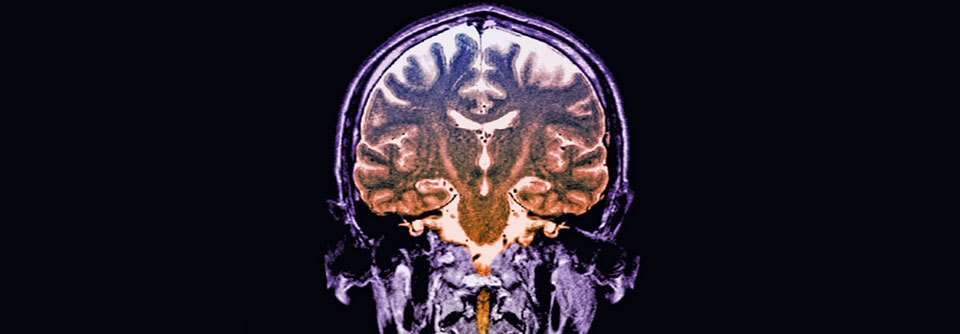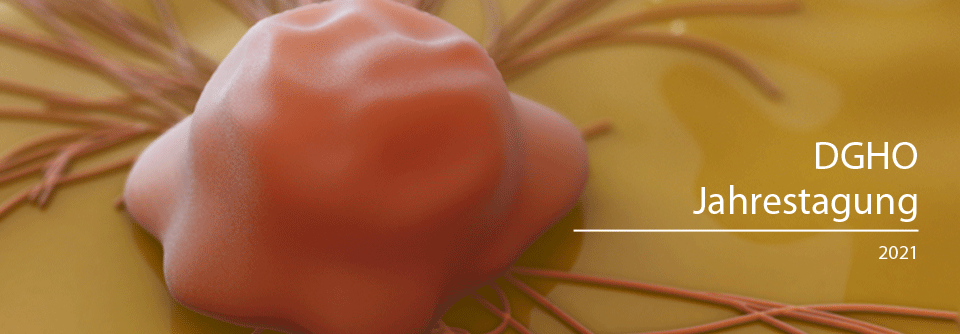
Palliativmedizin Besser Sterben
 Wie soll mit Schwerkranken und ihren Angehörigen umgegangen werden?
© iStock/kieferpix
Wie soll mit Schwerkranken und ihren Angehörigen umgegangen werden?
© iStock/kieferpix
1. Palliativversorgung in Pandemiezeiten
Gerade in der Corona-Pandemie ist die klassische Palliativversorgung zunächst stark in den Hintergrund gerückt. Um auch in Phasen wie dieser allen Patienten am Lebensende eine effektive Symptomkontrolle und ein würdevolles Sterben zu ermöglichen, haben Wissenschaftler um Professor Dr. Claudia Bausewein von der LMU München im Netzwerk Universitätsmedizin das Projekt Palliativversorgung in Pandemiezeiten (PallPan) initiiert.1
Insgesamt hat der Verbund eine nationale Strategie mit 33 Empfehlungen erarbeitet, wie mit Schwerkranken und ihren Angehörigen umgegangen werden soll. Sie richten sich an Versorgende, Leitungen von Einrichtungen und Diensten sowie Regierungen und kommunale Verwaltungen. Die drei Schwerpunkte lauten: Patienten und Angehörige unterstützen, ebenso Mitarbeitende, und die Angebote der Palliativversorgung aufrechterhalten. Als Beispiel nannte Prof. Bausewein unter anderem die Besucherregelung. Hier solle das Bedürfnis nach Nähe des Patienten in Abwägung mit dem Infektionsschutz der Bevölkerung eine immer größere Gewichtung erhalten, je näher die Sterbephase rückt.
Das Dokument ist hier als PDF erhältlich.
2. Heidelberger Meilenstein Kommunikation
Am Heidelberger Universitätsklinikum ist die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen ein zentraler Baustein der Palliativversorgung. In diesem Kontext stellte die Pflegewissenschaftlerin Anja Siegle von der Thoraxklinik das Projekt HeiMeKOM vor.2 Die Abkürzung steht für Heidelberger Meilenstein Kommunikation. Die Gesprächsphasen des Projekts sind in vier Meilensteine gegliedert und umfassen Gespräche zu Aufklärung, Konzept, Perspektiven und Konsens. Es sollen über den gesamten Erkrankungsverlauf die Informationsbedürfnisse, in diesem Fall von Lungenkrebspatienten, erkannt und erfüllt werden und es soll Kontinuität in der Kommunikation bestehen.
Die ausführlichen Meilensteingespräche führen Ärzte und Pflegende zusammen mit Patienten und Angehörigen. Jedes Mal folgen regelmäßige Follow-up-Telefonate zwischen Patienten und Pflegenden. Hier können offene Fragen geklärt und die „prognostic awareness“ sowie die palliativen Bedarfe erhoben werden, erklärte Siegle.
Gegenüber regulär versorgten Patienten reduzierte sich der Unterstützungsbedarf im Bereich Gesundheitssystem und Information bei den Teilnehmern des HeiMeKOM innerhalb der ersten drei Monate deutlich stärker. Nach sechs und neun Monaten waren aber keine Unterschiede mehr zu erkennen. Auch in Bezug auf Lebensqualität, Ängste und Depressivität. Als einen möglichen Grund nannte die Referentin, dass Patienten ohnehin jeden Tag um Normalität ringen und versuchen, die Symptome unter Kontrolle zu behalten.
Eine weitere Erkenntnis: Aufzeichnungen zum Thema Prognose und vorausschauende Versorgung fanden sich mit 20–30 % nur selten in den Unterlagen. Gesprochen wurde darüber trotzdem oft – doch nur, wenn die Erkrankten dazu bereit waren. Insofern könne auch fehlende Dokumentation ein Zeichen für patientenorientierte Kommunikation sein, folgerte Anja Siegle.
3. OncoCoach
Einen OncoCoach wollen Dr. Manfred Welslau vom Klinikum Aschaffenburg und Kollegen ihren Patienten zur Seite stellen.3 Diese speziell ausgebildete Pflegekraft übernimmt vom Arzt delegierte Leistungen, begleitet und schult Patienten und koordiniert durch die Versorgungsstruktur, macht also z.B. Termine. So geleitete Personen wissen einer früheren Studie zufolge besser über ihre Medikamente, deren Wirkungen und Nebenwirkungen Bescheid sowie darüber, was im Notfall zu tun ist. Sie entwickeln zudem eine höhere Selbstwirksamkeit.
Im Projekt OnCoPaTh untersuchen die Forscher nun, inwiefern sich über ein strukturiertes Versorgungsprogramm mit einem OncoCoach und einer konsiliarisch tätigen Palliativpflegefachkraft die Patientenkompetenz steigern, die Lebensqualität und Zufriedenheit der Patienten und Angehörigen sowie die frühe Integration der Palliativversorgung verbessern und die notfallbedingten Klinikeinweisungen verringern lassen. Als Vergleichsgruppen dienen Erkrankte mit Regelversorgung sowie mit Regelversorgung plus OncoCoach. Die Studie soll bis März 2024 laufen und in jedem Studienarm 600 Patienten umfassen.
4. Onkologische Pflegevisite
In eine ähnliche Richtung wie der OncoCoach geht die onkologische Pflegevisite (OPV), die am Krukenberg-Krebszentrum Halle über Fachpflegekräfte erfolgt.4 Sie dient dazu, die Pflege und Lebensqualität zu verbessern, den Beratungsbedarf von Patienten und deren Angehörigen sowie den Schulungsbedarf bei Pflegenden zu ermitteln, Pflegekräfte weiterzubilden und den kollegialen Austausch zu fördern.
In einem Vergleich von 96 OPV und 147 Standard-Dokumentationen bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren zeigte sich, dass die Visite zu einer besseren Versorgung der Krebspatienten beitragen kann. So wurden in der Standarddokumentation einige typische Begleitumstände der Erkrankung bzw. Therapie wie Obstipation, Diarrhö oder auch Appetitlosigkeit nur unzureichend erfasst, wie Jana Tietl, koordinierende Fachpflegekraft des Zentrums, darstellte. Bei einigen Beschwerden wie Mundtrockenheit gaben die Patienten in der OPV deutlich häufiger an, unter Symptomen zu leiden, als in der üblichen Versorgung. Außerdem erhielten sie häufiger Anleitungen zur Pflege, Pflegeprodukte sowie psychoonkologische oder sporttherapeutische Unterstützung. Deshalb lautete die Forderung von Tietl: „Jeder Patient sollte mindestens eine OVP erhalten!“
5. Krankheitsspezifische Patientenverfügungen
Ebenfalls relevant in der Palliativsituation ist die Entscheidung für oder gegen bestimmte Maßnahmen. Doch auch mit einer Patientenverfügung habe man immer wieder das Problem, nicht zu wissen, was der Betroffene eigentlich möchte, kritisierte Dr. Julia König, Internistin an der Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie, Universitätsmedizin Göttingen. In der SpezPat-Pilotstudie hat sie daher mit einem Team untersucht, ob präzisere krankheitsspezifische Patientenverfügungen das ändern können.5
Die Forscher passten dazu eine herkömmliche Verfügung speziell auf Patienten mit NSCLC im Stadium IV an und ließen diese von acht Erkrankten ausfüllen. Weitere sieben Patienten verwendeten das Originalformular. Danach gaben die Teilnehmer für verschiedene krankheitstypische Szenarien auf einer Likert-Skala an, ob sie bestimmte Therapieoptionen befürworten oder ablehnen. In einem letzten Schritt sollten Ärzte dann anhand der Verfügungen für die jeweiligen Krankheitsszenarien die mutmaßlich vom Patienten gewünschte Behandlung bestimmen.
Das gelang mit der spezifischen Patientenverfügung signifikant besser: Die Ärzte trafen in 83 % der Fälle die gleiche Entscheidung wie der Erkrankte. Mit der herkömmlichen Variante lag die Trefferquote nur bei 60 %. „Das ist fast wie eine Münze werfen“, verdeutlichte Dr. König die Daten. Nach ihrer Meinung sollte man den Ansatz mit dem krankheitsspezifischen Dokument in einer größeren Studie überprüfen. Aus Erfahrung könne sie aber auch sagen, dass manche Patienten sich mit den Entscheidungen teilweise sehr schwertun und dann vielleicht gar keine treffen. „Dafür brauchen wir eigentlich einen guten Back-up-Plan“, so ihr Fazit.
6. Palliativ-Fortbildung
Kevin Marciniak beschäftigte die Qualität der Pallativ-Fortbildung. Der Allgemeinmediziner aus Aachen evaluierte zusammen mit Kollegen, mit welchem Konzept angehende Palliativmediziner mehr lernen: mit der Kursweiterbildung inklusive Fallkonferenzen oder der sechs- bis zwölfmonatigen Weiterbildung auf einer Palliativstation.6 Dazu entwickelten die Forscher einen 40 Punkte umfassenden Fragebogen, mit dem die Teilnehmer ihr Wissen, ihre Fertigkeiten sowie ihre sozialen und persönlichen Fähigkeiten in den zehn Kernkompetenzen der Palliativmedizin vor und nach der Weiterbildung einschätzen sollten. Aus diesen Angaben ermittelten sie den Lernzuwachs.
Dabei war die Rotation den Ärztekursen in allen Kategorien überlegen. Zudem waren die Ergebnisse nach der zwölfmonatigen Praxisphase fast ausnahmslos besser als nach der sechsmonatigen. Ein Pflicht-Praxisteil wäre also begrüßenswert, so der Kollege. Er hätte aber auch einen Nachteil: Er wäre für Niedergelassene oder Fachärzte in einer Klinik praktisch nicht realisierbar.
Quellen:
1. Bausewein C. DGHO-Jahrestagung 2021; Palliativmedizin in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie
2. Siegle A et al. DGHO-Jahrestagung 2021; Abstract V209
3. Welslau M et al. DGHO-Jahrestagung 2021; Abstract V511
4. Tietl J et al. DGHO-Jahrestagung 2021; Abstract V363
5. König J et al. DGHO-Jahrestagung 2021; Abstract V404
6. Marciniak K et al. DGHO-Jahrestagung 2021; Abstract V710