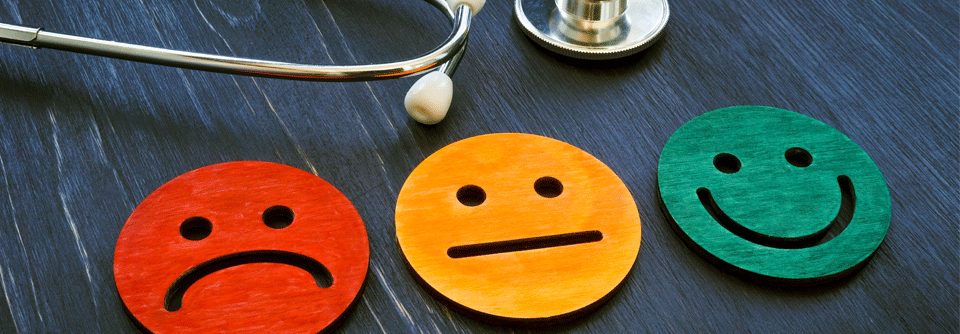Palliativpatienten mit Migrationshintergrund brauchen bessere Kommunikation
 Menschen mit Migrationshintergrund wünschen sich medizinische, soziale und rechtliche Kompetenz sowie ausreichend Zeit. (Agenturfoto)
© iStock/FatCamera
Menschen mit Migrationshintergrund wünschen sich medizinische, soziale und rechtliche Kompetenz sowie ausreichend Zeit. (Agenturfoto)
© iStock/FatCamera
Bedürfnisse von Palliativpatienten sind nicht migrations- oder kulturspezifisch. Menschen mit Migrationshintergrund wünschen sich ebenso medizinische, soziale und rechtliche Kompetenz sowie ausreichend Zeit. Dr. Christian Banse von der Klinik für Palliativmedizin der Universitätsmedizin Göttingen und seine Kollegen haben Palliativpatienten mit Migrationshintergrund sowie deren Angehörige und das medizinische und pflegende Personal zur Versorgungssituation befragt.
Alle Interviews wurden offen in der jeweiligen Muttersprache geführt. Die insgesamt 21 teilnehmenden Krebspatienten stammten aus der ehemaligen Sowjetunion, der Türkei, Syrien, Pakistan, Polen, Albanien, dem Kosovo, Kroatien und dem Iran. Hinzu kamen sieben Angehörige (Kinder und Ehepartner) sowie 20 Versorgende (Ärzte, Pfleger, Psychologen) und neun Schnittstellenakteure.
Obwohl sich die grundsätzliche Situation und die Wünsche von Patienten mit Migrationshintergrund nicht von denen ohne unterscheiden, fühlen sich viele aufgrund ihrer Herkunft anders behandelt und ausgegrenzt. Das Netz der verschiedenen medizinischen Versorgungsebenen erscheint oft sehr unübersichtlich.
Statusverlust wird durch Krebserkrankung verstärkt
Insbesondere bei einer Sprachbarriere fühlen sich Betroffene als „dumm“ wahrgenommen, wie sich aus den Gesprächen entnehmen ließ. Es mangelt an auf die Situation angepasster Information und Kommunikation. Denn auch wenn die Wünsche allgemein formuliert sind, darf der individuelle Migrationskontext nicht außer Acht gelassen werden.
Durch die Krebserkrankung wird der mit der Migration nach Deutschland erlebte ökonomische und soziale Statusverlust oft verstärkt. Die Betroffenen schämen sich gegenüber dem persönlichen Umfeld und den Pflegenden, haben das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, auch was die Rollenverteilung betrifft (z.B. Kinderbetreuung bei Frauen). Einige trauen sich nicht in den Familien offen über ihre Wünsche, z.B. nach Entlastung, und Sorgen zu kommunizieren und wollen ihren Angehörigen nicht zur Last fallen.
Manche haben sich auch auf der Suche nach einer besseren medizinischen Versorgung nach Deutschland begeben und entweder dafür ihr eigenen finanziellen Rücklagen aufgebraucht oder sogar Verwandte um Geld gebeten. Einige sind auch von ihren Familien getrennt, weil diesen Geld oder eine Aufenthaltserlaubnis fehlen.
Angehörige bemängelten ihrerseits, dass das medizinische Personal sie häufig als reine Sprach- und Interessenvermittler abstempelt. Die resultierende Verantwortung stellt sie unter einen enormen Druck, sich für „das Richtige“ zu entscheiden. Außerdem werden sie dadurch z.T. unmittelbar mit Befunden konfrontiert, ohne dass man ihre emotionale Beteiligung berücksichtigt. Gleichzeitig fehlen auch ihnen häufig Informationen über pflegerische und psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten in der Palliativsituation.
Häufig übersetzt ungeschultes Personal
Sprachbarrieren werden auch von den Versorgenden als großes Problem angesehen. Medizinisch geschulte professionelle Sprachmittler fehlen häufig und bedeuten einen Mehraufwand bei unklarer Finanzierung. Folglich greift man auf ungeschultes Personal zurück – Familienmitglieder, Putzkräfte, Fahrer.
Darf man das Thema Sterben überhaupt ansprechen?
Dass weniger Menschen mit Migrationshintergrund Palliativangebote in Anspruch nehmen, wird oft mit „anderen kulturellen Gepflogenheiten“ begründet. Insgesamt besteht beim medizinischen Personal oft Verunsicherung, wie man mit der vermeintlich „fremden Kultur“ umgehen soll. Darf man z.B. das Thema Sterben und Tod überhaupt ansprechen? Dies kann zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führen – genauso wie die Unmöglichkeit, Erwartungen oder Wünschen am Lebensende, wie eine Rückkehr in die Heimat oder den Nachzug enger Verwandter, gerecht zu werden.
Besonders stark wirkt sich der Migrationskontext auf die Versorgung von Geflüchteten mit unklarem rechtlichem Status aus. Droht ihnen oder ihren Familienmitgliedern eine Abschiebung, resultiert daraus nicht nur ein emotionaler, sondern auch ein zeitlicher Druck. Interviewt wurden in dieser Studie nur Patienten, die einen Weg zu den palliativen Versorgungsstrukturen gefunden haben, geben die Autoren zu bedenken. Eine Aussage, wie häufig solche Angebote überhaupt wahrgenommen werden, konnte daher nicht gemacht werden.
Quelle: Banse C et al. Dtsch Med Wochenschr 2021; 146: e22-e28; DOI: 10.1055/a-1263-3437